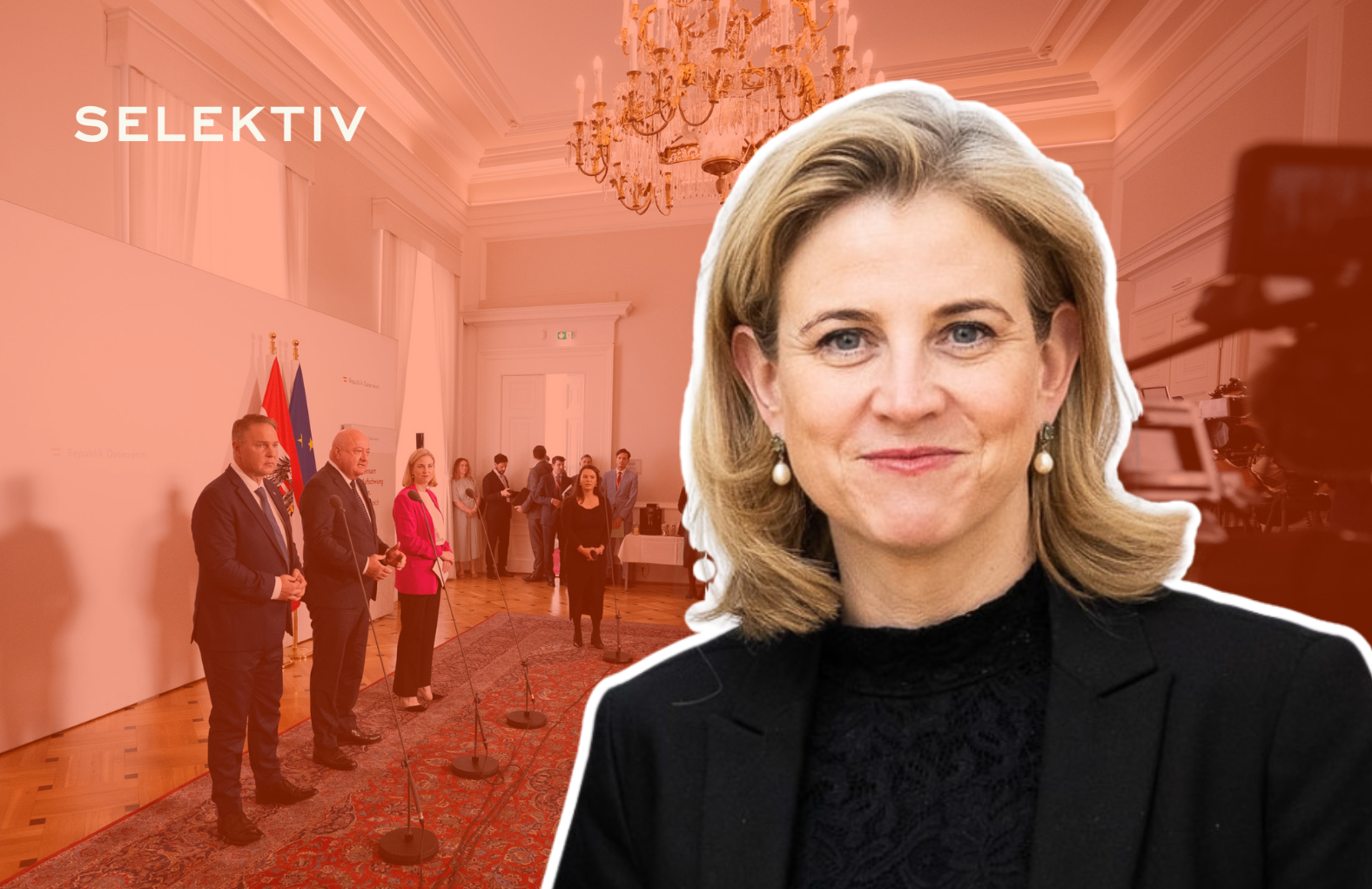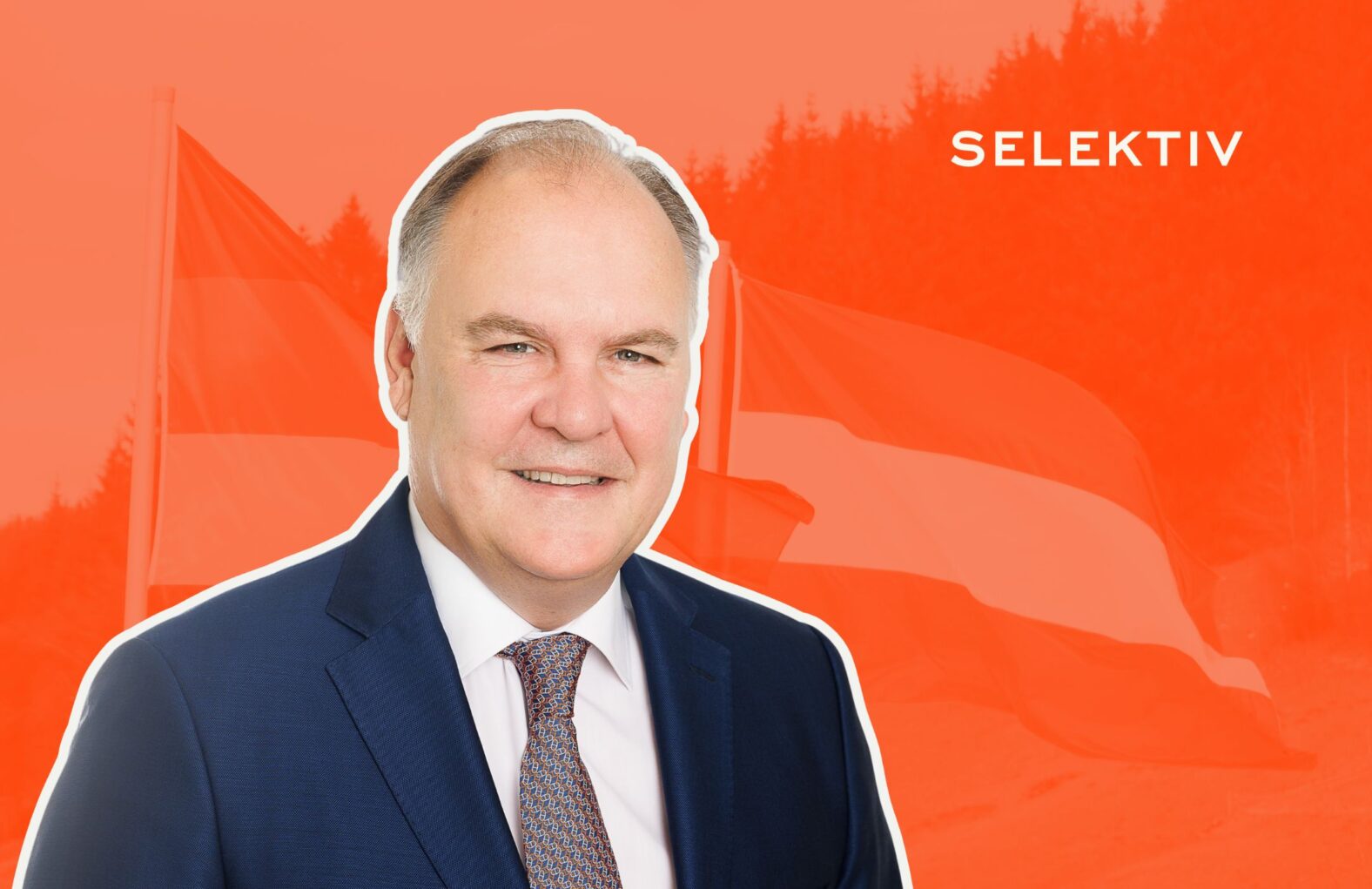Im Oktober ist die Arbeitslosigkeit zum 31. Mal in Folge gestiegen, stark betroffen war erneut die Industrie. Wifo-Ökonom Rainer Eppel sieht hierbei „konjunkturelle und strukturelle Probleme“ aufeinandertreffen. Ein Teil der verlorengegangenen Jobs in der österreichischen Industrie wird daher dauerhaft verloren sein – der Großteil der Arbeitslosigkeit sollte aber nur temporär sein. Mit Stabilisierung der Konjunktur würden die Betriebe auch wieder Personal aufbauen. Um das „Nebeneinander von hoher Arbeitslosigkeit und einer hohen Zahl offener Stellen“ zu durchbrechen, müssen laut Eppel „ungenutzte Arbeitskräftereserven mobilisiert“ werden. Bei Konjunktur- und Arbeitsmarktprognosen bestehen laut Eppel „große Abwärtsrisiken“, da neben den internationalen Unsicherheiten auch unklar ist, wie sich der fiskalische Konsolidierungsbedarf hierzulande weiterentwickeln wird und welche Konsequenzen das haben könnte.
Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober zum 31. Mal in Folge gestiegen. Ist die Wirtschaftskrise zumindest am Arbeitsmarkt also noch nicht vorbei?
Rainer Eppel: Wir spüren nach wie vor die Folgen der anhaltenden Konjunkturschwäche – das Beschäftigungswachstum bleibt verhalten und die Arbeitslosigkeit steigt weiter. Die Krise ist am Arbeitsmarkt also noch nicht überwunden. Eine Trendwende ist derzeit nicht in Sicht. Dafür müsste sich zunächst die Konjunktur spürbar beleben, worauf der Arbeitsmarkt dann mit einer gewissen Verzögerung reagieren würde.
Besonders betroffen ist weiterhin die Industrie und daher auch die Industriebundesländer. Sind die Industriearbeitsplätze, die jetzt verloren gehen, für immer verloren?
Hier überlagern sich konjunkturelle mit strukturellen Problemen, daher lässt es sich nicht so klar trennen. Die Industrie ist besonders stark von der Konjunkturschwäche betroffen, sie leidet unter der schwachen internationalen Nachfrage, den hohen Energiepreisen und auch den hohen Lohnsteigerungen der jüngeren Vergangenheit. Typischerweise reagiert die Industrie relativ früh und stark auf Veränderungen in der Konjunktur. Ein großer Teil der Arbeitslosigkeit ist hier also sicher nur temporär – sobald sich die Konjunktur stabilisiert, werden die Betriebe auch wieder Personal aufbauen. Es ist aber nicht alles konjunkturell bedingt. Es gibt auch tiefgreifendere, strukturelle Veränderungen, die dazu führen, dass ein Teil der Arbeitsplätze dauerhaft verloren geht.
Die Pensionsreform erhöht das Arbeitskräfteangebot von Frauen ab 60 Jahren stark.
Rainer Eppel
In der aktuellen Arbeitslosenstatistik scheint aufgrund des angehobenen Frauenpensionsantrittsalters bei Frauen über 60 eine höhere Arbeitslosigkeit auf (plus 2.100 Personen) aber gleichzeitig auch höhere Beschäftigung (plus 19.300 Personen). Wie bewerten Sie die Entwicklung?
Die Pensionsreform erhöht das Arbeitskräfteangebot von Frauen ab 60 Jahren stark. Das Wifo schätzt, dass dadurch allein in den Jahren 2024 bis 2026 die Zahl der Arbeitskräfte insgesamt um rund 50.000 steigt. Die Reform führt also auf jeden Fall zu einer deutlichen Ausweitung des Arbeitskräfteangebots. Das schlägt sich einerseits in deutlich mehr Beschäftigten, aber andererseits auch in mehr arbeitslosen Frauen nieder. Die Angleichung des Frauenpensionsalters hat positive Effekte, indem sie zu einer längeren Erwerbstätigkeit von Frauen führt, was zur Entlastung des Pensionssystems beiträgt und die Arbeitskräfteengpässe reduziert. Umgekehrt entstehen Risiken, weil schon jetzt viele Frauen – knapp 30 % – nicht direkt aus der Beschäftigung in die Pension übergetreten sind. Entscheidend ist also, wie gut es gelingt, die Ausweitung des Arbeitskräfteangebots in aktive Beschäftigung zu übersetzen.
Wird es weitere negative Auswirkungen auf Konsum und Konjunktur geben, wenn bald die saisonale Arbeitslosigkeit, vor allem in der Baubranche, schlagend wird?
Natürlich hat die saisonale Arbeitslosigkeit einen dämpfenden Effekt auf den Konsum, weil diese Menschen zumindest temporär arbeitslos sind und ihnen daher weniger Einkommen zur Verfügung steht. Aber es ist nur ein kurzfristiger Konsumdämpfer. Im Frühjahr haben wir dann wieder einen Anstieg und dann normalisiert sich das Ganze wieder.
Das vom Wifo prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,1 % für 2026 würde ausreichen, um eine Wende am Arbeitsmarkt einzuleiten.
Rainer Eppel
Im Oktober sind die offenen Stellen mit minus 13 % erneut zweistellig zurückgegangen – ist auch das ein Anzeichen für die weiterhin schwache Konjunktur?
Ja, auch das ist ein Anzeichen für die weiterhin schwache Konjunktur. Das Niveau an offenen Stellen ist aber historisch gesehen immer noch relativ hoch. Das weist darauf hin, dass trotz steigender Arbeitslosigkeit weiterhin Arbeitskräfteengpässe bestehen. Der anhaltende Rückgang der offenen Stellen spiegelt auf jeden Fall die nach wie vor angespannte Wirtschaftslage wider.
Mit dem 1. Halbjahr 2026 soll dann auch am Arbeitsmarkt eine Verbesserung eintreten. Wie schätzen Sie die Situation ein und welche Abwärtsrisiken bestehen in dieser Prognose?
Die österreichische Wirtschaft hat die Rezession überwunden, doch von einem kräftigen Aufschwung kann noch keine Rede sein. Der Arbeitsmarkt steht weiterhin im Zeichen dieser Schwäche. Das vom Wifo prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,1 % für 2026 würde aber ausreichen, um eine Wende am Arbeitsmarkt einzuleiten. Wir gehen daher davon aus, dass die Arbeitslosenquote von 7,5 % auf 7,3 % sinken wird.
Es gibt aber noch erhebliche internationale, geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Auch innerhalb Österreichs besteht die Unsicherheit, dass wir nicht genau wissen, wie sich der fiskalische Konsolidierungsbedarf weiterentwickeln wird. Die Finanzlage der Länder und Gemeinden dürfte ungünstiger sein als erwartet. Das könnte stärkere Budgetkonsolidierungsbemühungen notwendig machen – auch das sind Unwägbarkeiten. Es bestehen also große Abwärtsrisiken.
Entscheidend ist daher, bisher ungenutzte Arbeitskräftereserven zu mobilisieren.
Rainer Eppel
Sollte die Konjunktur wieder anspringen, könnte dann der Fachkräftemangel wieder stärker schlagend werden?
Wir beobachten derzeit ein Nebeneinander von hoher Arbeitslosigkeit und einer weiterhin hohen Zahl offener Stellen. Das wird trotz der jüngeren Entwicklungen so bleiben. Das Wachstum des Arbeitskräfteangebots ist demografiebedingt nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen schrittweise das Pensionsalter, was zwar die Arbeitslosigkeit dämpft, aber gleichzeitig zu anhaltenden Arbeitskräfteengpässen führt.
Entscheidend ist daher, bisher ungenutzte Arbeitskräftereserven zu mobilisieren – also etwa Arbeitslose, rund 140.000 Teilzeitkräfte, die gerne mehr Stunden arbeiten würden, und über 300.000 Personen, die derzeit aus unterschiedlichen Gründen nicht aktiv Arbeit suchen, aber eigentlich gerne arbeiten möchten. Um diese Reserven zu mobilisieren, müssen bestehende Erwerbshindernisse abgebaut werden, wobei hier an vielen Schrauben gedreht werden muss – die eine Stellschraube gibt es nicht.
Zuletzt herrschte in der Regierung Uneinigkeit über die Regelung zu den Überstunden-Freibeträgen. Was wäre aus arbeitsmarktpolitischer Sicht am sinnvollsten?
Ich fürchte, dass solche Überstundenbegünstigungen mit hohen Mitnahmeeffekten verbunden sind – viele Überstunden würden auch ohne steuerliche Entlastung geleistet. Damit erhöhen sie das Arbeitskräfteangebot kaum, belasten aber in Zeiten knapper Budgets zusätzlich die öffentlichen Finanzen.
Hinzu kommen mögliche negative Effekte auf Gesundheit und Gleichstellung. Ein Großteil der Überstunden wird von Männern geleistet. Zusätzliche Anreize für längere Arbeitszeiten könnten die ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Care-Arbeit weiter verschärfen, weil Frauen dadurch noch mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen müssten.
Um Gruppen mit großem ungenutztem Potenzial – Arbeitslose, Personen in der stillen Reserve oder unfreiwillig Teilzeitbeschäftigte – stärker in den Arbeitsmarkt einzubinden, müsste man an strukturellen Hürden ansetzen: etwa bei der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung, fehlenden Qualifikationen, gesundheitlichen oder sprachlichen Einschränkungen sowie besseren Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen.