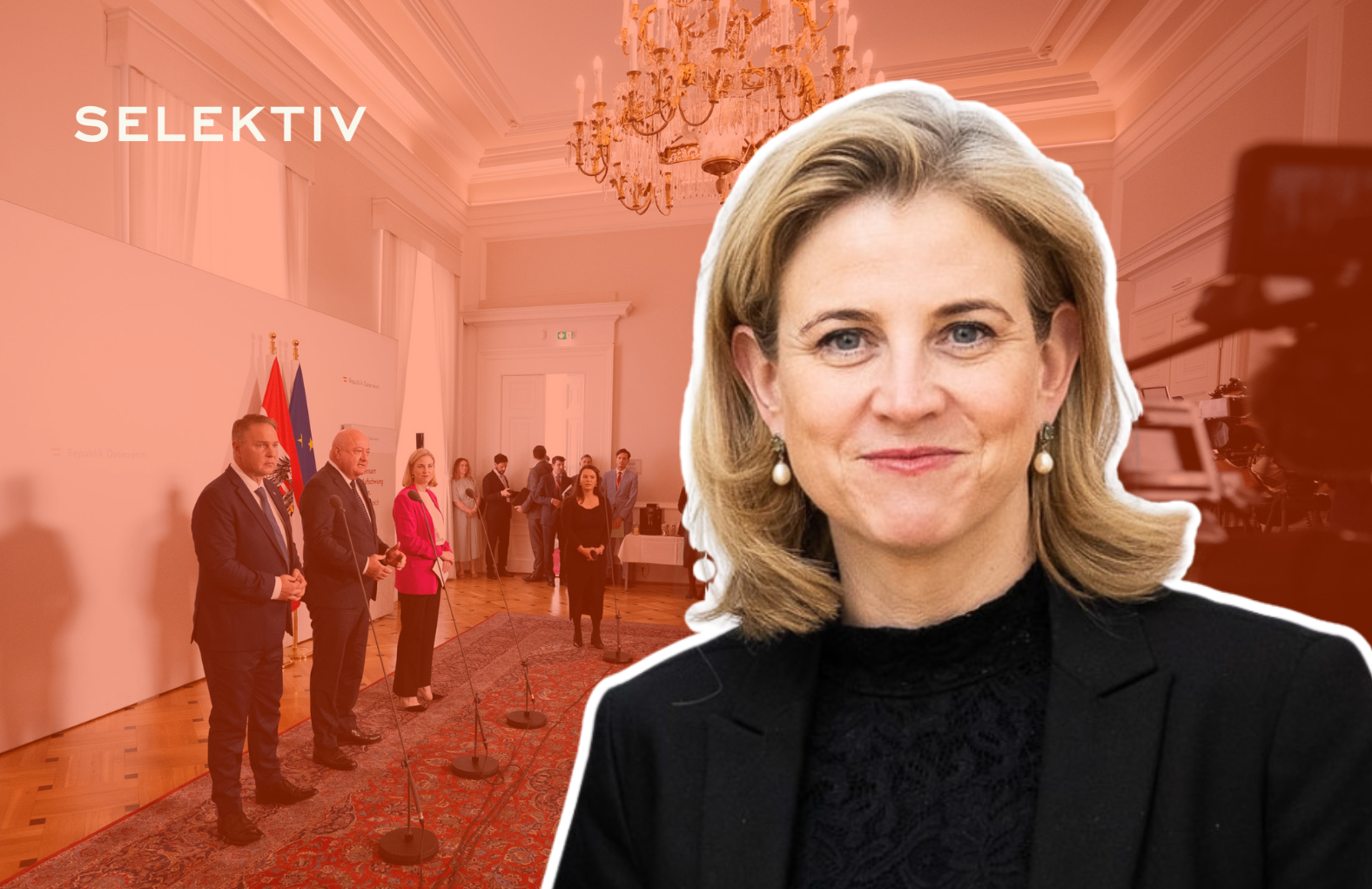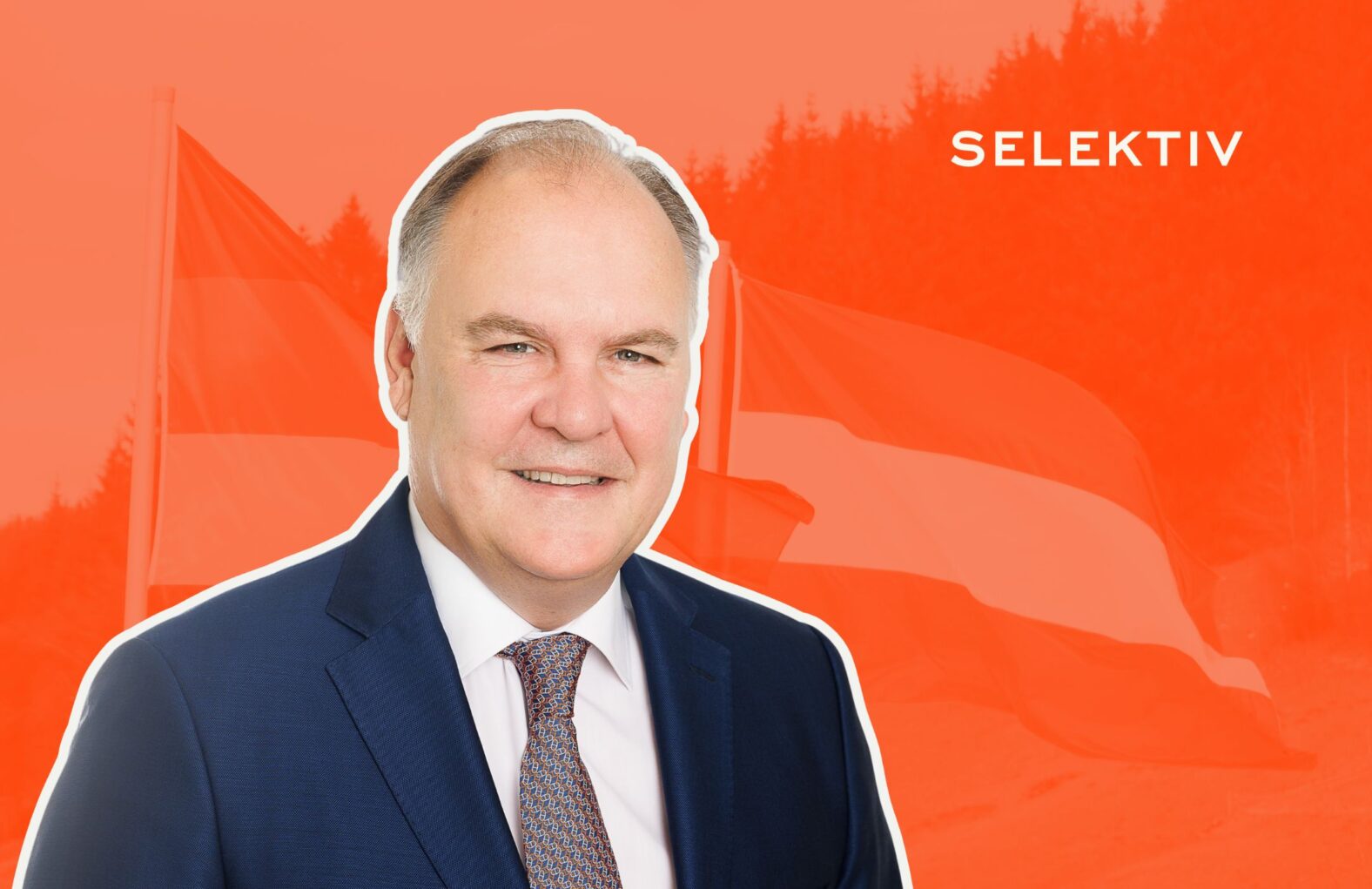Die Europäische Union und die USA haben sich am 27. Juli auf einen „Deal“ geeinigt. EU-Importe in die USA sollen ab heute mit einem Zollsatz von 15 % belegt werden, während US-Importe in die EU zum Nulltarif möglich sein sollen. Rechtssicherheit bringt dieser „Deal“ nicht – er ist klar rechtswidrig, sagt Völker- und Handelsrechtsexperte Ralph Janik. Würde die EU versuchen, diesen Deal in EU-Recht zu gießen, könnte sie sich rasch Klagen anderer Länder ausgesetzt sehen.
Heute tritt der „Deal“ zwischen den EU und den USA in Kraft. Mit den 15-prozentigen Zöllen sind natürlich viele unzufrieden, aber immer wieder wird betont, dass jetzt immerhin Rechtssicherheit herrsche. Aber herrscht überhaupt Rechtssicherheit?
Nein, wir haben derzeit keine Rechtssicherheit. Wir haben nur dann Rechtssicherheit, wenn sich alle an die Regeln des „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT) und das sonstige WTO-Recht halten. Im Streitbeilegungssystem der WTO ist explizit festgehalten, dass Rechtssicherheit eine Grundvoraussetzung für Handel ist. Das war der Konsens, auf den man sich in den Verhandlungsrunden, die zur Gründung der WTO geführt haben, geeinigt hat. Rechtssicherheit würde bedeuten, dass Klarheit über die konkrete Ausgestaltung der Zölle herrscht und falls diese nachverhandelt werden sollten, das nicht auf Basis bilateraler „Deals“ geschieht, sondern Verhandlungen mit mehreren Handelspartnern geführt werden und alle gleich behandelt werden.
In der derzeitigen Situation wird es sowohl für Exporteure als auch für Importeure schwieriger. Die Herkunft von Gütern muss jetzt für jedes einzelne Land genau erhoben werden. Eigentlich war der alte Grundgedanke der Meistbegünstigungsklausel, dass immer derselbe Zoll gilt – egal, aus welchem Land eine Ware kommt. Jetzt muss man stetig damit rechnen, dass US-Präsident Trump irgendwann sagt, ich erhebe wieder höhere Zölle oder jetzt kriegt ihr vielleicht wieder einen besseren Deal, weil ihr euch brav verhalten habt.
Ungeachtet dessen, dass wir jetzt einen Deal haben, weiß niemand, wie lange der hält. Oder ob nicht auch dieser Deal irgendwie kollabiert, wenn Trump erneut auf die Idee kommt, einzelne Waren aus der EU unterschiedlich zu behandeln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Trump irgendwann auf die Idee kommt, zum Beispiel auf deutsche Autos höhere Zölle einzuheben als auf irgendwelche Waren aus Litauen. Für Trump und seine Administration ist die EU als solche ja ein Feindbild. Er hat glaube ich noch immer nicht ganz verstanden, dass die EU als gemeinsamer Handelsblock auftritt und nicht die einzelnen Länder.
TTIP ist bekanntlich gescheitert. Das rächt sich jetzt.
Wir haben also keine Rechtssicherheit, wir haben derzeit auch noch keinen Vertragstext. Kann also heute rechtlich ein neues Zollregime in Kraft treten, wenn außer der Absichtserklärung vom 27. Juli nichts vorliegt?
Eigentlich nicht, nein. Für sowas braucht man immer einen offiziellen Handelsvertrag, der auch entsprechend ratifiziert wird. Deswegen ist es auch gut, wenn wir hier wirklich von einem „Deal“ sprechen, weil das kein verbindlicher, völkerrechtlicher Vertrag ist. Einen solchen Vertrag auszuhandeln, würde auch entsprechend lange dauern. Mit den USA wollten wir mit dem „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) einen solchen Vertrag vor längerer Zeit aushandeln. Das ist bekanntlich gescheitert. Das rächt sich jetzt.
Im Gegensatz dazu sind „Deals“ Vereinbarungen, von denen man überhaupt gar nicht sagen kann, ob sie Rechtscharakter haben oder welchen Rechtscharakter sie haben sollen. Die EU bezeichnet den Deal mit den USA als „politische Vereinbarung“, also eine Art Zusicherung, eine Absichtserklärung beider Seiten. Aus europarechtlicher Sicht stellt sich für die EU schon die Frage, auf welcher Grundlage geben wir den USA Zollfreiheit? Weil rechtlich gelten für uns immer noch die GATT- und allgemeinen WTO-Regeln.
Die Verhandlungen zu Handelsabkommen dauern oft Jahre oder gar Dekaden, bis man zu einem Ergebnis kommt – oder im Fall von TTIP auch zu keinem Ergebnis, Sie haben es angesprochen. Dieser „Deal“ zwischen den USA und der EU war nur wenige Wochen in Verhandlung – wie lang wird der Vertrag noch hinter den Kulissen nachverhandelt werden müssen?
Was hier vorliegt, ist allgemein mal sicher kein Handelsvertrag. Ein solcher müsste die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 8 des GATT erfüllen. Das liegt hier aber nicht vor, weil ein Handelsvertrag den gesamten Handel liberalisieren müsste. Außerdem verstößt der Deal gegen Art. 1 des GATT, die Meistbegünstigungsklausel: Jedes Land muss gleich behandelt werden, der höchste Standard für eines gilt automatisch für alle. Hier könnten andere Staaten die EU klagen – denn nicht nur die USA, sondern auch die EU verletzt diese Meistbegünstigungsklausel, wenn sie sich auf diesen Deal einlässt.
Wenn also ein anderes Land – zum Beispiel Indien oder Vietnam – auch einen 0-%-Zoll für Autoimporte in die EU haben wollen würde, wie dieser jetzt den USA zugesichert wurde, dann könnte es die EU bei der WTO klagen. Das ist eben der Grundgedanke der Meistbegünstigung, dass nicht immer alle miteinander und untereinander verhandeln müssen, sondern dass eine Einigung unter zwei WTO-Mitgliedern auch für alle anderen 164 gilt.
Wenn dieser Deal kein Handelsvertrag ist und gegen geltendes Handelsrecht verstößt, wie kann dieser dann rechtskonform in EU-Recht und dann in nationalstaatliches Recht gegossen werden?
Ich frage mich tatsächlich, wie dieser Deal in EU-Recht gegossen werden soll. Die EU ist an das Völkerrecht gebunden und auch ein WTO-Mitglied. Etwas so offensichtlich gegen WTO-Recht und Völkerrecht Verstoßendes kann die EU nicht problemlos in EU-Recht gießen – sollte man meinen.
Dieser Deal sieht auch hunderte Milliarden Dollar an Investitionen vor. Die EU hat 750 Mrd. US-Dollar an Energieeinkäufen zugesagt sowie Investitionen von 600 Mrd. US-Dollar in den USA. Sind diese Zusagen noch weniger bindend?
Die Europäische Kommission kann höchstens Anreize für Privatunternehmen einleiten, um in den USA zu investieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst hat offen zugegeben, dass sie nichts garantieren kann. Es wirkt aber eher so, als wäre vieles davon schon ohnehin zugesagt gewesen und jetzt wird hier mit eindrucksvollen Zahlen jongliert, zum Beispiel mit den Militärausgaben. Diesen Eindruck gewinnt man auch, wenn man sich die Deals mit anderen Ländern, zum Beispiel Japan, ansieht. Es scheint die Taktik vorzuherrschen, Trump erstmal große Versprechungen zu machen, damit er damit medial hausieren gehen kann, dann darauf zu hoffen, dass langfristig nicht so genau hingeschaut wird oder nicht mehr gefragt wird, wie viel davon tatsächlich eingehalten wurde.
Dennoch sieht es derzeit ganz klar danach aus, dass die EU in der schwächeren Verhandlungsposition war. Weil es eben keine rein wirtschaftlichen Verhandlungen waren, sondern geoökonomische Verhandlungen. Das war weniger verhandeln und mehr schon erpressen.
Die EU sitzt ganz klar auf dem kürzeren Ast.
Für die EU-Kommission arbeiten insgesamt 32.000 Personen, sicher nicht alle in Handelsfragen. Aber das US-amerikanische Verhandlerteam wirkte dann doch eher zusammengewürfelt und nicht so, als hätten sie zehntausende Beamte als Rückendeckung. Wie konnte man da in der schlechteren Verhandlungsposition sein?
Diese Verhandlungen werden nicht so geführt, wie man sie üblicherweise kennt. Üblicherweise kommt jeder mit seinen Zahlen, mit einzelnen Lobbyinteressen und mit volkswirtschaftlichen Interessen des jeweiligen Landes zum Verhandlungstisch und man tauscht rational die Argumente aus. So ist das zum Beispiel noch unter der ersten Amtszeit von Donald Trump geschehen. Ein Beispiel: Die USA hatten damals ein Interesse daran, Hummer zum Null-Zoll-Tarif nach Europa zu exportieren.
Die EU hatte im Gegenzug das Interesse, zum Beispiel Fertiggerichte, Glaswaren, Feuerzeuge und Einzelbestandteile von Zigarettenanzündern – ja, tatsächlich – in die USA zu exportieren. Da haben sie von den USA eine 50-%-Kürzung der Zölle bekommen. Solche Verhandlungen sind oft sehr technisch, weil es wirklich um einzelne Produkte und deren Bestandteile geht, wo dann auch entsprechende Lobbyinteressen dahinterstehen. Gleichzeitig werden diese Verhandlungen für gewöhnlich ganz rational geführt.
Die jetzigen Verhandlungen liefen nicht so ab. Hier ging es um Emotion. Das waren nicht mehr rein wirtschaftliche, sondern geoökonomische, vermischt mit geopolitischen und sicherheitspolitischen Fragen – und hier sitzt die EU ganz klar auf dem kürzeren Ast.
Wäre eine Option, die WTO ohne die USA weiterzubetreiben – wenn diese sich nicht mehr an deren Regeln gebunden fühlt. Eine WTO-minus-1, wie sie unter anderem auch Wifo-Chef Gabriel Felbermayr vorgeschlagen hat, wäre das realistisch?
Da ist ein Ausflug in die Geschichte angebracht: In den 1940er-Jahren, also lange vor der WTO, wollte man eine Sonderorganisation für Handel innerhalb der UNO ins Leben schaffen, wie auch zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation WHO. Gescheitert ist diese Internationale Handelsorganisation, kurz ITO, aber daran, dass es im US-Kongress keine Mehrheit gab und Präsident Truman dann während des Koreakriegs aufgegeben hat, beizutreten.
Bei der Gründung der WTO hat man aus dem Scheitern der ITO gelernt. Es war von Anfang an klar, dass man eine Welthandelsorganisation nicht ohne die größten Volkswirtschaften der Welt betreiben kann. Somit mussten die USA jedenfalls an Bord sein. Mit demselben Argument hat man dann auch rasch China hineingeholt. Jetzt sind wir aber in der absurden Situation, dass zwar alle Staaten dabei sind, aber sich die USA nicht mehr an die Regeln halten, vielleicht sogar aussteigen wollen.
Die EU hat in diesem Fall die Arschkarte.
Man muss deswegen zwar keine neue WTO gründen, könnte aber sehr vieles plurilateral lösen. Der Begriff „plurilateral“ wird in Abgrenzung zu „multilateral“ verwendet – multilateral bedeutet im WTO-Kontext, dass alle 166 Mitglieder zustimmen müssten. Wenn man jetzt plurilaterale Abkommen trifft oder sogenannte „Koalitionen der Willigen“ findet, dann könnte man neue Übereinkünfte treffen, bei denen aber nicht alle WTO-Mitglieder teilnehmen oder zustimmen müssen. Da bin ich ganz bei Herrn Felbermayr.
Nur: Darauf werden die USA sehr kritisch schauen. Zum Beispiel, dass sich die EU jetzt nicht zu sehr an China annähert, oder dass sich China, Indien und Russland nicht zu stark annähern. Die EU hat in diesem Fall die Arschkarte, verzeihen Sie mir die Ausdrucksweise. Bis in die 2000er-Jahre war man in der EU der Meinung, dass Handel Frieden schafft. Dass jemand von diesem Grundkonsens abweichen könnte, war uns Europäern nicht bewusst. Daher ist auch niemand auf die Idee gekommen, uns militärisch unabhängig zu machen. Ganz im Gegenteil, man ist bewusst abhängig geblieben. Wir dachten, die Freundschaft der USA ist bedingungslos. Jetzt ist aber die ganze Freundschaft kaputt.
In einer solchen Situation sind Verhandlungen mit den USA verdammt schwer. Was man der EU vorhalten kann, ist, dass man schon viel früher auf die veränderte geopolitische Lage reagieren hätte müssen – spätestens in der ersten Amtszeit Donald Trumps. Lange Zeit haben wir Europäer gehofft, dass Trump eine Ausnahme ist. Spätestens jetzt sollte aber allen bewusst sein, dass das jetzt vielleicht die Regel wird. Nach diesem Trump könnte noch ein Trump II oder ein Trump III kommen.
Zur Person
Ralph Janik ist Assistenzprofessor an der Sigmund Freud Privatuniversität, Lehrbeauftragter an der Universität Wien, der Andrassy Universität in Budapest und der Universität der Bundeswehr in München.