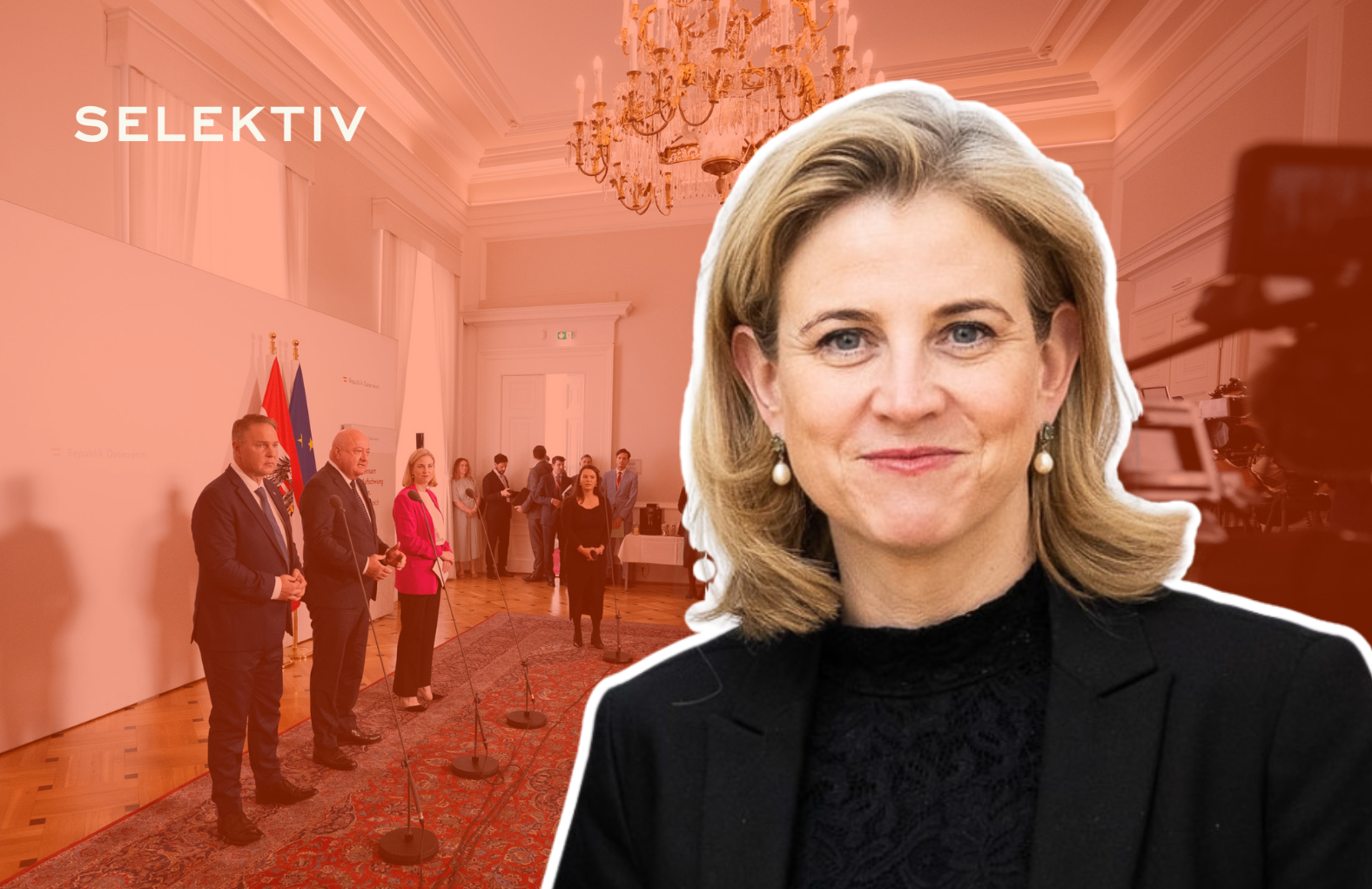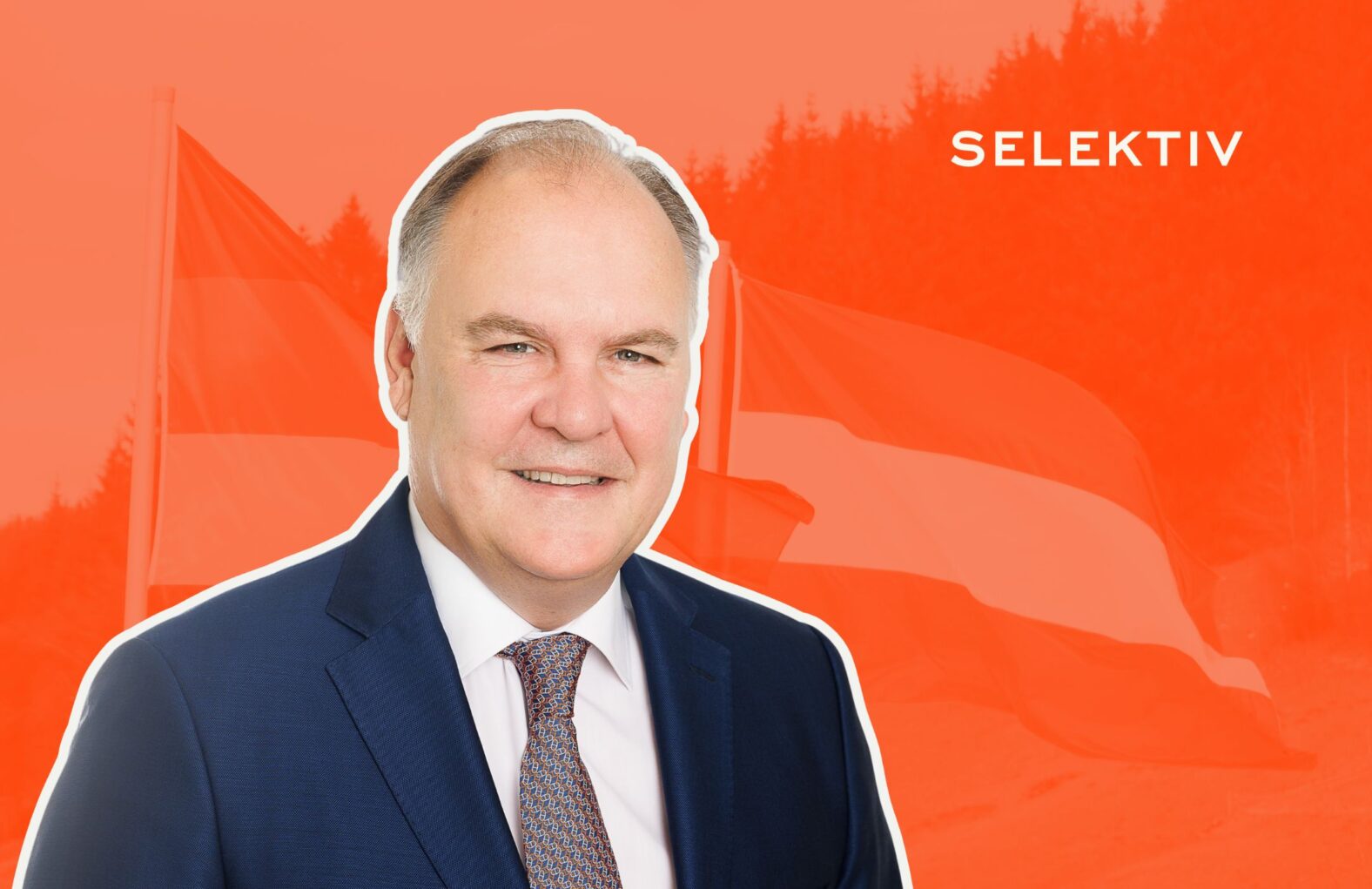– Interview von Sara Grasel und Christoph Hofer
Eine gemeinsame wirtschaftspolitische Vision der Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos dürfte sich laut Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nur schwer ausgehen: „Man kann nur verteilen, was zuerst erwirtschaftet wurde. Da gibt es in der Koalition einen sehr großen Unterschied in der Sichtweise“, sagt er im Interview mit Selektiv. Angesprochen auf die zahlreichen staatlichen Eingriffe wie Strompreisbremse, Mietpreisbremse oder Übergewinnsteuern, bekennt sich der Wirtschaftsminister „zu Angebot und Nachfrage und zum Wettbewerb“, in einigen Fällen seien aber im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft „ordnungspolitische Maßnahmen“ notwendig.
Die SPÖ hat mit den „breiten Schultern“ einen sehr klaren wirtschaftspolitischen Standpunkt formuliert. Ist das ein Zielbild, das auch die ÖVP teilt und gibt es eine gemeinsame wirtschaftspolitische Vision dieser Regierung?
Wolfgang Hattmannsdorfer: Ich glaube, unser Profil ist eindeutig. Unsere primäre Mission ist es, das Comeback von Leistung und Wettbewerb zu schaffen. Nur wenn wir leistungsfreundlich und wettbewerbsbereit werden, können wir Wirtschaftswachstum schaffen und nur mit Wirtschaftswachstum können wir den Sozialstaat absichern. Man kann nur verteilen, was zuerst erwirtschaftet wurde. Da gibt es in der Koalition einen sehr großen Unterschied in der Sichtweise. Aber es ist wichtig, dass die Bundesregierung kompromissfähig ist, denn der tägliche Streit auf ideologischer Ebene hätte große Nachteile. Es gibt leider nicht einen Knopf, auf den man drückt, und dann ist das Wirtschaftswachstum da. Ich darf jetzt seit vier Monaten Wirtschaftsminister sein – und wenn ich mir anschaue, was wir da schon für den Standort auf den Tisch legen konnten: ein Leistungspaket, die Abschaffung der leistungsfeindlichen Bildungskarenz, die Abschaffung des geringfügigen Zuverdiensts in der Arbeitslosigkeit, die steuerfreie Mitarbeiterprämie oder künftig etwa Steueranreize für Leute, die das Pensionsantrittsalter erreichen.
Helmut Kohl soll einmal gesagt haben, dass ab 50 Prozent Staatsquote der Sozialismus beginnt. Da sind wir in Österreich schon lange – also bei der Staatsquote über 50 – macht Ihnen das keine Sorgen?
Das stört mich sogar. Das ist kein Ruhmesblatt, auf das man stolz sein kann. Fakt ist aber auch, dass wir das Budget konsolidieren müssen. Das Ziel muss aber sein, dass wir mit der Staatsquote runterkommen: Leistung rauf, Wettbewerb rauf, Staat runter.
In den letzten Jahren gab es – teilweise krisenbedingt, aber nicht nur – viele staatliche Eingriffe, die die ÖVP mitgetragen hat: Mietpreisbremse, Übergewinnsteuern, etc. Kann man aus Sicht der ÖVP dem freien Markt nicht mehr trauen?
Volles Bekenntnis zu Angebot und Nachfrage und zum Wettbewerb. Das ist die einzige Grundlage für unser Wohlstandsmodell. Es gibt aber ordnungspolitische Aufgaben, wenn es um die Rahmenbedingungen geht – zum Beispiel bei den Energiepreisen. Auch in der Daseinsvorsorge haben wir eine Verantwortung. Das machen wir zum Beispiel mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz mit der Preis-runter-Garantie. Die Frage der ökosozialen Marktwirtschaft ist immer, mit einem klaren Bekenntnis zur Regelung von Angebot und Nachfrage, dort einzugreifen, wo ordnungspolitische Maßnahmen notwendig sind. Ich habe mit genug Wirtschaftsliberalen gesprochen, die die Frage der explodierenden Strom- und Energiekosten als zentralen Wettbewerbsnachteil sehen. Dann regulatorisch einzugreifen, halte ich für wesentlich.
Viele Ökonomen warnen vor Eingriffen wie der Mietpreisbremse.
Das Thema Mietpreisbremse ist der koalitionären Kompromissfähigkeit unterzuordnen. Für mich als Wirtschaftsminister ist es wichtig, dass wir in der Frage des Wettbewerbs eine klare Linie fahren.
Lebensmittel sind starke Preistreiber bei der Inflation – können Sie sich auch da Preiseingriffe vorstellen?
Da muss man die Kirche im Dorf lassen. Wenn man sich die Entwicklung der Preise im EU-Vergleich ansieht, schert Österreich nicht aus. Die beste Form der Inflationsbekämpfung ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Ich bin kein Freund von groß ausgestatteten, nicht gesteuerten Fördersystemen. Wo wir, glaube ich, im Bereich der Lebensmittel Handlungsbedarf haben ist dort, wo es wirklich zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Da schauen wir mit der Bundeswettbewerbsbehörde hin – Stichwort Österreich-Aufschlag.
In ihrem aktuellen Bericht schreibt die Bundeswettbewerbsbehörde, dass der heimische Strommarkt regional segmentiert ist und von wenigen Playern dominiert wird. Welche Reformen bräuchte es, für mehr Preiswettbewerb? Sollte man die bestehenden Kreuzbeteiligungen entflechten?
Ich bin der Bundeswettbewerbsbehörde sehr dankbar, dass sie diesen Bericht vorgelegt hat. Das ist der ideale Zeitpunkt, weil wir gerade mit dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) die größte Strommarktreform der letzten 20 Jahre in Begutachtung geschickt haben und viele Themen, die die Wettbewerbsbehörde anspricht, in diesem Gesetzesentwurf eingearbeitet wurden. Ob es um die Strompreis-runter-Garantie geht oder die Weiterentwicklung der E-Control, was ihre Aufsichts- und Wettbewerbsfunktion betrifft, damit sinkende Börsenpreise schneller an die Kunden weitergegeben werden. Oder die dynamischen Stromtarife und Maßnahmen für höhere Tarifwechselraten. Wir übernehmen zentrale Punkte des BWB-Berichts.
Mir ist wichtig, dass wir in den Strommarkt mehr Wettbewerb hineinbringen. Ich sehe aber das Thema der Kreuzbeteiligungen nicht so absolutistisch wie die Wettbewerbsbehörde, weil es gute Gründe dafür gibt. Wir haben Mega-Investitionsprojekte vor uns im Bereich des Erneuerbaren-Ausbaus und da ist es gut, dass unsere Stromversorger auch gemeinsame Sachen machen können. Zweitens gebe ich schon zu bedenken, dass diese Beteiligungsstrukturen auch dafür sorgen, dass wir stabile Eigentümer haben. Ich glaube, gerade in Fragen der Daseinsvorsorge, in Fragen der Energieerzeugung, ist es gut, wenn man solche stabilen Eigentümerverhältnisse hat. Was wir sicher machen müssen, ist, dass wir bei künftigen Beteiligungen noch besser hinsehen, was die Auswirkungen auf Märkte angeht.
Kreuzbeteiligungen machen in der Frage der Energieproduktion Sinn. Im Bereich des Handels müssen wir mehr Wettbewerb hineinbringen. Die Antwort ist jedoch nicht das Gesellschaftsrecht, sondern das Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das machen wir.
Mit der BWB haben wir auch einen Dissens beim Thema der monatlichen Rechnung. Wenn man im Sommer eine niedrige Stromrechnung hat, hat man vielleicht nicht am Radar, dass im November oder Dezember, die Strom- oder die Gasrechnung wieder ansteigt. Dann baut man vielleicht die Haushaltsplanung auf falschen Parametern auf. Deswegen halte ich es für richtig, dass wir eine Jahresrechnung haben. Im ElWG wird jetzt aber eine Opt-out-Möglichkeit eingeführt.
Seit der Schüssel-Ära sind Privatisierungen in Österreich rar geworden, fast schon ein Tabuthema. Auch jetzt angesichts von Rekorddefiziten und -schulden werden diese kaum thematisiert. Dabei wären doch ÖBAG-Beteiligungen wie z. B. die Post oder die Casinos Austria prädestiniert für (Teil-)Privatisierungen. Wie sehen Sie das?
Also grundsätzlich, glaube ich, sollte man österreichisches Familiensilber nicht zum Flicken von Budgetlöchern verscherbeln. Weil alles, was wir jetzt veräußern, dient ausschließlich dem Stopfen von Budgetlöchern. Und dazu sind mir die Beteiligungen zu schade, weil diese auch ein ganz wichtiger Dividendenbringer für die Republik sind, mit fast 1,3 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn ich mir die Unternehmen ansehe, die Post und weitere, sind diese hoch erfolgreich und auch wichtig und gut für den Staat.
„Man sollte österreichisches Familiensilber nicht zum Flicken von Budgetlöchern verscherbeln.“
Wolfgang Hattmannsdorfer
Was ich aber glaube, und deswegen erhält die ÖBAG auch eine neue Strategie, wir müssen schon kritisch hinterfragen, wie schaut das Beteiligungsportfolio der ÖBAG aus? Was ist die Aufgabe einer Staatsbeteiligung? Zu den Vorgaben gehören die Verantwortung für standortpolitische Wettbewerbsrahmenbedingungen, insbesondere Energie und Infrastruktur, und ein Schlüsseltechnologiefokus. Die ÖBAG hat nicht die Rolle, irgendwelche strauchelnden oder maroden Industriebetriebe aufzukaufen, sondern wenn sie investiert, dann in standortrelevante Schlüsseltechnologien, wo es Wachstumspotentiale für die Republik gibt.
Außerdem sollen die Unternehmen Verantwortung für das Ökosystem in ihrem Umfeld übernehmen – Verbund und OMV im Bereich Energie, A1 beim Cloud-Management und die Post bei der Logistik. Es geht nicht nur darum, Dividende abzuliefern, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, um Start-ups und Scale-ups zu entwickeln.
Und die vierte Vorgabe ist für mich die Skalierung nach oben, Auslandsbeteiligungen. Wir sehen hier, wie das kleines Österreich plötzlich am Weltmarkt mitspielt, wenn unsere Flagship-Unternehmen international auftreten im Bereich von Beteiligungen oder Mergers. Das beste Beispiel ist die OMV. Wir schaffen gerade den viertgrößten Polyolefin-Konzern der Welt. In Relation zum Weltmarkt schwimmen wir da plötzlich ganz vorne mit.
Österreich ist derzeit ein bisschen wie ein Unternehmen, das weniger Umsätze macht und keine bessere Idee hat, als die Preise zu erhöhen. Gibt es keinen besseren Plan als einnahmenseitige Maßnahmen?
Zum Beispiel die Reisepassgebühr? (lacht)
Die Bankenabgabe, der Energiekrisenbeitrag Strom, die Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten, Glücksspielabgabe etc.
Ich habe eine andere Sicht der Dinge. Ja, wir müssen das Budget konsolidieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir dann im Laufe der Zeit auch noch einen Schritt mehr machen müssen. Es war immer der Plan, dass wir 2029 wieder die 3-Prozent-Masstricht-Grenze beim Defizit erreichen. Das IHS sagt, dass es 3,2 Prozent werden. Das heißt, es ist wichtig, auf diesem Konsolidierungspfad zu bleiben.
Das IHS sagt aber auch, dass wir beim Defizit auf 2 Prozent des BIP kommen müssen, um Spielräume zu haben.
Man wird nicht von heute auf morgen die Fehler der Vergangenheit auflösen können. Im Rückspiegel ist das immer leichter, aber Österreich ist gut durch die Krisen gekommen und auch oft gelobt worden für die Krisenmaßnahmen. Jetzt bekommen wir dafür die Rechnung geschickt. Jetzt sollten wir aber nicht in den Rückspiegel schauen, sondern versuchen, wieder auf die Überholspur zu kommen. Mit den Paketen, die wir ganz offensiv in den ersten Monaten auf den Weg gebracht haben, liefert die Bundesregierung in diesem Bereich. Dazu gehört auch das Mittelstandspaket, die Verdopplung der Basispauschalierung, die NoVA-Befreiung für die Kasten- und Pritschenwägen.
Was den Unternehmen gut gefallen würde, wäre eine Lohnnebenkostensenkung.
Die Lohnnebenkostensenkung ist klar im Regierungsprogramm verankert, der Schwerpunkt liegt aber jetzt auf der Konsolidierung. Im nächsten Schritt werden wir eine Lohnebenkostensenkung einleiten müssen. Das versteht auch jeder, dass wir jetzt den Fokus auf die Budgetkonsolidierung legen müssen – wenn ein Prozent Lohnnebenkostensenkung netto 1,1 Milliarden Euro kostet, dann ist das 2025 und 2026 leider nicht drin.
„Wenn ein Prozent Lohnnebenkostensenkung netto 1,1 Milliarden Euro kostet, dann ist das 2025 und 2026 leider nicht drin.“
Wolfgang Hattmannsdorfer
Die SPÖ macht nachhaltig keinen Hehl daraus, dass sie sich Vermögensteuern gut vorstellen könnte. Das steht nicht im Regierungsprogramm, aber viel Widerspruch hört man aus der ÖVP auch nicht. Ist das etwas, dass Sie sich unter Umständen doch noch vorstellen könnten?
Nein. Das ist, glaube ich, eine sehr deutliche Antwort. Vermögensteuern wird es mit uns nicht geben. Wir müssen attraktiv bleiben für Investoren und wir müssen schauen, dass wir Kapital an Österreich binden können – diese Maßnahmen würden zu einem Exodus führen.

Österreich ist eine Bürokratiehochburg. Bis jetzt war die Regierung in puncto Deregulierung noch nicht sehr aktiv, obwohl dies im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen nichts kosten würde. Gibt es hier Blockaden? Wann kann man mit ersten spürbaren Entlastungen rechnen?
Wir sollten uns hier nicht im Klein-Klein aufhalten, sondern groß denken, was die Entbürokratisierung betrifft. Ich glaube, einer der größten heimischen Wettbewerbsnachteile ist die Frage der Genehmigungsverfahren, der Behördenverfahren allgemein. Wenn ich mir vorstelle, dass die Tauernleitung 17 Jahre in der Behördenschleife steckte. Das ist ein Unding und das darf es in Zukunft auch nicht mehr geben. Wir haben jetzt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz in die koalitionäre Koordinierung geschickt, wo es genau darum geht, dass wir im Energiebereich Verfahren deutlich beschleunigen, z. B. durch eine höhere Bewertung des öffentlichen Interesses. Wir werden auch eine Novelle des UVP-Gesetzes und des AVG-Gesetzes vorlegen. Es braucht Vereinfachungen im Betriebsanlagenrecht. Das UVP-Gesetz ist nicht von heute auf morgen novelliert, aber wir müssen hier schneller werden.
In welche Richtung wird es bei der UVP-Novelle gehen? Gibt es schon konkrete Ansatzpunkte?
Ein wesentliches Thema ist die Frage der Verfahrenskonzentration, insbesondere dort, wo mehrere Behörden bzw. Gebietskörperschaften involviert sind. Also die konsequente Installierung eines One-stop-shop-Prinzipes, sodass ich nur einen Ansprechpartner auf Behördenseite habe und sich die Behörden den Rest untereinander ausmachen. Und der zweite wesentliche Schlüssel ist, wie schon erwähnt, die Definition des öffentlichen Interesses in der Güterabwägung, etwa in einem Beeinspruchungsverfahren.
Gibt es bezüglich One-stop-shop ein entsprechendes Commitment der Länder? In den letzten 10, 20 Jahren ist diese Thematik ja schon in vielen Regierungsprogrammen gestanden. Gekommen ist es nicht.
Sie können davon ausgehen, wenn ich das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz in die koalitionsinterne Koordinierung schicke, dass ich mit den Ländern, die meiner Fraktion angehören, gesprochen habe. Ich glaube, es war ein Fehler der Vergangenheit, insbesondere im Energiebereich, immer mit dem moralischen Zeigefinger alles zu diktieren. Wir setzen jetzt auf Partizipation und Einbindung. Weil ich habe nichts davon, wenn ich energiepolitisch oder klimapolitisch mit dem moralischen Zeigefinger dastehe und am Ende des Tages politisch gar nichts durchbringe, so wie in der letzten Periode. Es geht nur mit reden, reden, reden. Bei mir daheim in Oberösterreich gibt es den Spruch „beim Reden kommen die Leute zam“. Wenn man das in der Politik beherzigt, dann schafft man auch die großen Reformen.
„Ich habe nichts davon, wenn ich energiepolitisch oder klimapolitisch mit dem moralischen Zeigefinger dastehe und am Ende des Tages politisch gar nichts durchbringe, so wie in der letzten Periode.“
Wolfgang Hattmannsdorfer
Sie haben vor kurzem eine Sonderkommission für Bürokratieabbau angekündigt. Gleichzeitig gibt es einen eigenen Deregulierungs-Staatssekretär, der gerade eine Anlaufstelle für Entbürokratisierung einrichtet. Das klingt für mich ein bisschen wie bei den Bürgern von Schilda. Man möchte Doppelgleisigkeiten reduzieren und schafft dann zwei Stellen, die im Wesentlichen dasselbe tun.
Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Erstens, die Zahnräder greifen ineinander. Ich arbeite mit Sepp Schellhorn eng zusammen z. B. bei der Industriestrategie. Er wird in dieser Strategie das Kapitel Deregulierung und Entbürokratisierung verantworten. Es geht nur mit einem gemeinsamen Wurf. Diese Sonderkommission zum Bürokratieabbau betrifft dieses Haus, betrifft den Stubenring, betrifft das Wirtschaftsministerium. Ich glaube, das sollte es in jedem Ministerium geben. Nicht nur sagen, was andere machen sollen, sondern vor der eigenen Haustüre kehren und überlegen, wo können wir besser werden. Auch wir als Wirtschaftsministerium können massiv besser werden. Etwa im Bereich der Gewerbeanmeldung, was die Digitalisierung betrifft, im Bereich der Exportkontrolle, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Unsere Kundinnen und Kunden sind die österreichischen Unternehmen. Und für diese müssen wir möglichst effizient und gut aufgestellt sein.
Um das ElWG auf den Boden zu bringen, brauchen Sie die Stimmen von den Grünen oder der FPÖ. Beide scheinen noch nicht ganz überzeugt – könnten die viel kritisierten Punkte der Spitzenkappung und der Netzgebühren für Erzeuger noch nachverhandelt werden?
In Energiefragen braucht es einen nationalen Schulterschluss, es sollten alle Parteien für die größte Strommarktreform stimmen.
Sind die Spitzenkappung und die Netzgebühren für Erzeuger Verhandlungsmasse, um das zu erreichen?
Wir brauchen mehr Fairness im Stromsystem. Es kann nicht sein, dass wir für teures Geld Fluss- und Laufkraftwerke abschalten müssen, weil jemand am Sonntagnachmittag Strom einspeist, wenn die Sonne scheint, aber niemand Strom braucht. Die einen verdienen damit Geld, aber wir alle müssen die Kosten tragen. Bei der Spitzenkappung muss man die Kirche im Dorf lassen. Bei PV-Anlagen geht es um den Überschussstrom und da reden wir wahrscheinlich von drei Prozent des Überschusses, den ich dann nicht ins Netz einspeisen kann.
Die Kritik bezieht sich vor allem auf die größeren Windanlagen.
Da geht es um zwei Prozent der Jahreserzeugung. Und die wird ja nicht aus Jux und Tollerei gekappt, sondern aus Systemnotwendigkeit. Wir glauben, dass wir durch die Spitzenkappung 30 Prozent mehr Netzpotenziale heben können und reden von Einsparungen von zig Milliarden im Netzinfrastrukturausbau.
„Wir glauben, dass wir durch die Spitzenkappung 30 Prozent mehr Netzpotenziale heben können und reden von Einsparungen von zig Milliarden im Netzinfrastrukturausbau. “
Wolfgang Hattmannsdorfer
Also keine Verhandlungsmasse?
Das Gesetz ist in Begutachtung und da wird es immer eine Diskussion geben. Man muss sich aber immer die Frage stellen, ob man will das die Energiepreise steigen oder sinken. Wer will, dass sie sinken, muss zwingend netzdienliche Maßnahmen setzen.
Sozialministerin Korinna Schumann ist dafür, dass Unternehmen bei der Beschäftigung Älterer einen Beitrag leisten, und kann sich Strafen für Unternehmen vorstellen. Sie auch?
Das wird es mit uns nicht geben. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir Anreize für Unternehmen schaffen. Erste Ansätze gibt es schon, etwas bei der Arbeitslosenversicherung und bei einigen Lohnnebenkosten. Vielleicht können wir da noch attraktiver werden. Aber mit uns wird es keine Bestrafung geben. Ehrlich gesagt kann ich kein IT-Unternehmen dafür verantwortlich machen, dass es nicht ausreichend 65-jährige Programmierer beschäftigt oder einen Dachdecker dafür, dass er keine 65-Jährigen aufs Dach schickt.
Zur Person
Wolfgang Hattmannsdorfer (45) ist Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Der ÖVP-Politiker war davor Sozial- und Integrationslandesrat in Oberösterreich, ehe er mit Jahresbeginn bis zu seinem Eintritt in die Bundesregierung Generalsekretär der Wirtschaftskammer wurde.