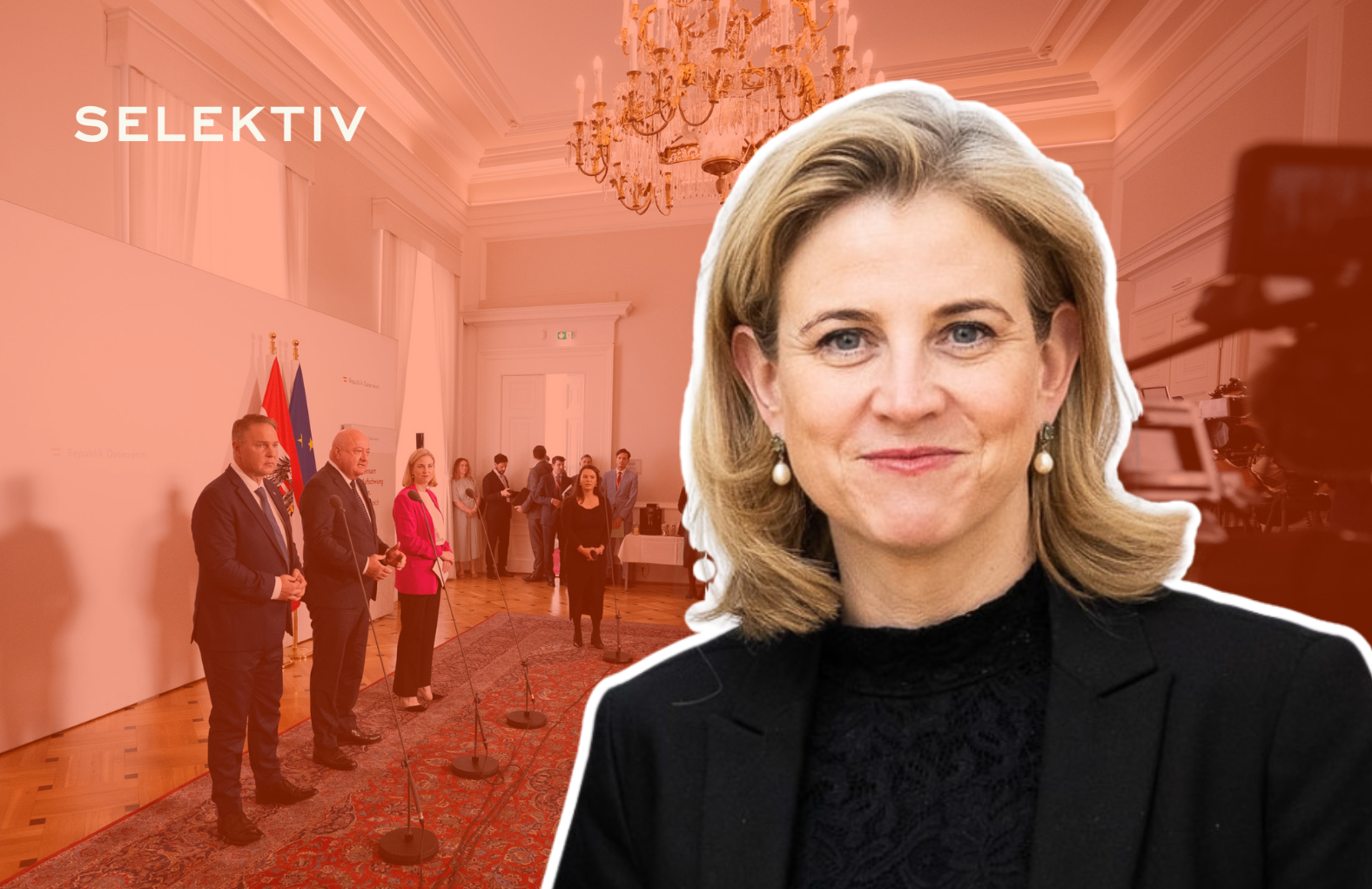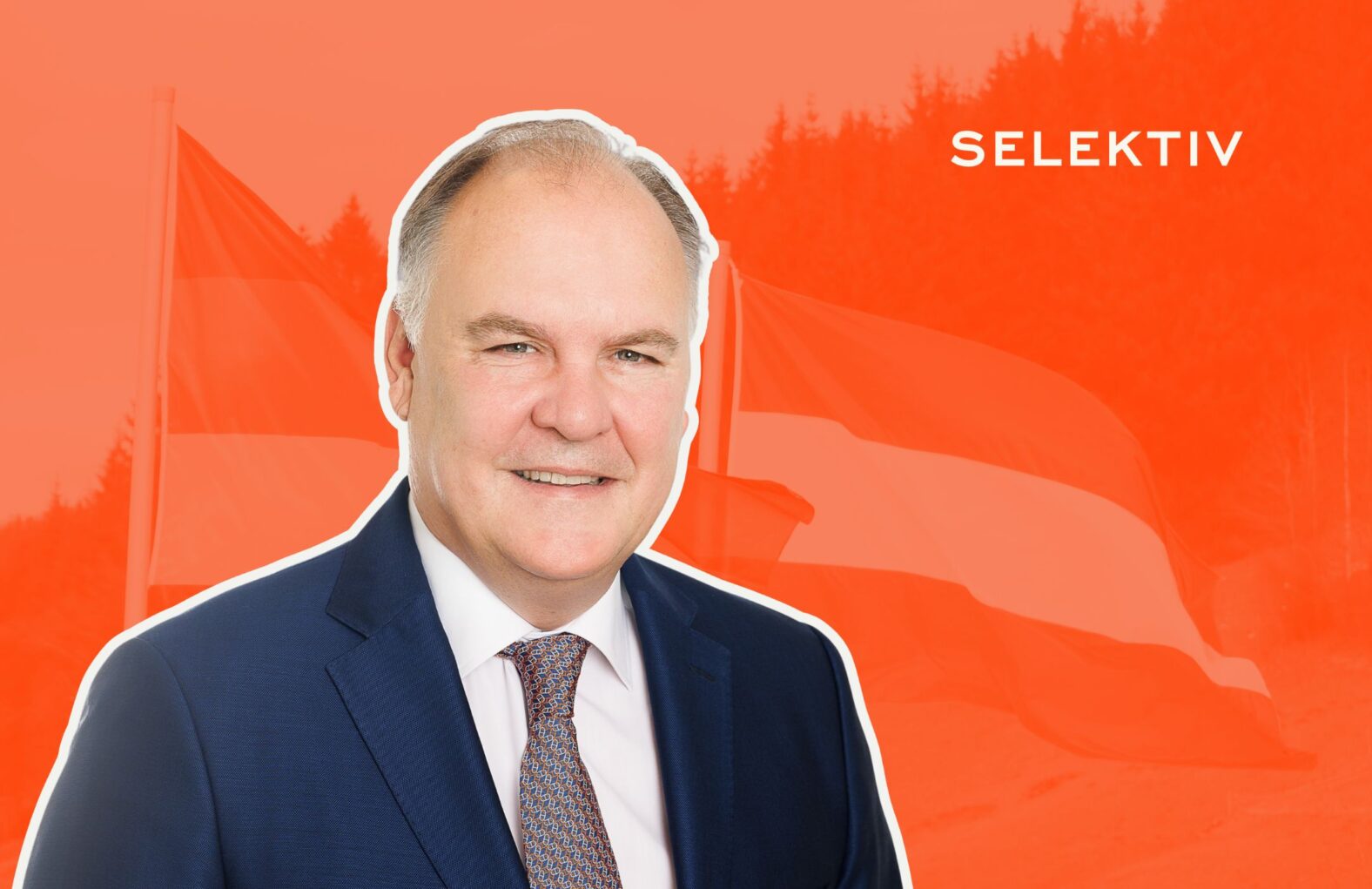Die EU-Kommission arbeitet an Schutzmaßnahmen für die Stahl- und Aluminiumindustrie, die heute vorgestellt werden sollen. Im Vorfeld fordert Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer ein umfassendes Schutzpaket für die Stahlindustrie, die derzeit besonders unter Druck steht. „In der Stahl- und Aluminiumindustrie sind in den letzten Jahren rund 30.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Wir sehen eine dramatische Schieflage: Die weltweiten Überkapazitäten im Stahlbereich, vor allem aus China, übersteigen die EU-Nachfrage inzwischen um das Fünffache“, sagt Hattmannsdorfer zu Selektiv und fordert niedrigere Importquoten und höhere Zölle. Außerdem müsse der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) erweitert werden, um die heimische Industrie vor chinesischer Überproduktion zu schützen.
Heute soll das Stahlpaket der EU kommen mit einer Verdopplung der Importzölle. Europa importiert sehr viel Stahl – für wen und was genau soll diese Verdopplung auf 50 % gelten?
Wolfgang Hattmannsdorfer: Wir haben mit anderen Ländern eine Allianz geschlossen, die ebenfalls hohe Wertschöpfungsanteile in der Schwerindustrie haben – zum Beispiel Frankreich, Italien oder Deutschland. Wir glauben, dass die EU angesichts der aktuellen Herausforderungen aufwachsen muss. Wir haben uns in den letzten Jahren schrittweise aus dem Markt gepreist bei Energiekosten, Lohnstückkosten und einer überbordenden Bürokratie. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es aufgrund der geoökonomischen Verwerfungen nicht zu weiteren Entwicklungen kommt, die die Industrie aus Europa vertreiben. Für die Stahlindustrie spielt einerseits die starke Zollpolitik der USA eine Rolle, aber auch die massiven Überkapazitäten Chinas. Deshalb fordern wir von der Europäischen Union einen Schutzschirm für die Stahlindustrie, die Aluminiumindustrie und die Kupferindustrie.
Wie sieht es denn beim Export aus? Die EU ist einer der größten Stahlexporteure und der zweitwichtigste Zielmarkt sind die USA. Dort gelten aber auch hohe Schutzzölle. Sehen Sie noch eine Chance, hier einen Deal mit Trump zu machen, z. B. für ganz bestimmte Stahlprodukte, die in den USA gar nicht produziert werden?
Ich erwarte mir von der EU-Kommission, dass hier weiterverhandelt wird. Gerade im Rahmen des sogenannten „Golfclub-Deals“ zwischen Trump und von der Leyen wurde bereits ein erster Schritt gemacht – mit Zollfreiheit für bestimmte europäische Produkte und einem 15-%-Zollsatz, der rückwirkend ab August gilt. Das darf aber nicht das Ende sein. Jetzt braucht es weitere Gespräche, und zwar in zwei Bereichen: Erstens zu den hohen 50-%-Zöllen auf Stahl, Aluminium und Kupfer – hier muss es Ausnahmen geben, insbesondere für Produkte, die in den USA gar nicht hergestellt werden. Und zweitens sollte die Liste der zollfreien Waren erweitert werden. Da laufen aktuell noch Diskussionen, etwa zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen und pharmazeutischen Produkten. Für mich ist klar: Die Gespräche mit Trump sind noch nicht abgeschlossen – hier gibt es noch Spielraum für konkrete Lösungen.
Wie stark hat sich die Lage in der Stahlindustrie in Europa verschlechtert?
Die Lage in der europäischen Stahlindustrie hat sich massiv verschlechtert. Allein in der Stahl- und Aluminiumindustrie sind in den letzten Jahren rund 30.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Wir sehen eine dramatische Schieflage: Die weltweiten Überkapazitäten im Stahlbereich, vor allem aus China, übersteigen die EU-Nachfrage inzwischen um das Fünffache. Das setzt unsere Industrie gezielt unter Druck – auch durch staatlich geförderte Dumpingpreise. Hinzu kommt, dass durch US-Schutzzölle Handelsströme umgelenkt werden und verstärkt in die EU drängen.
Deshalb fordern wir eine deutliche Reduktion der Importquoten und höhere Schutzzölle, um unsere Betriebe zu schützen. Gleichzeitig müssen die kostenlosen CO₂-Zertifikate verlängert werden. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie die Voest einerseits Milliarden in die Dekarbonisierung investiert, aber gleichzeitig Milliarden für Emissionszertifikate zahlen muss – das ist weder fair noch wirtschaftlich tragbar. Was es jetzt braucht, ist ein Umdenken: mehr Selbstbewusstsein für europäische Industriepolitik – etwa durch einen „Made-in-Europe“-Bonus im Vergabe- und Beihilferecht. Während andere Länder ihre Märkte schützen, dürfen wir in Europa nicht tatenlos zusehen. Wir müssen gezielt investieren und dürfen uns nicht selbst blockieren.
Die Lage in der europäischen Stahlindustrie hat sich massiv verschlechtert.
Wolfgang Hattmannsdorfer
Welche Rolle könnte da die öffentliche Beschaffung spielen? Wieviel Stahl kaufen öffentliche Auftraggeber und woher beziehen die den Stahl bisher?
Das im Detail zu beziffern ist nicht meine Aufgabe, aber eines ist klar: Die öffentliche Beschaffung kann ein starkes Instrument sein, um die europäische Industrie gezielt zu stärken. Wenn wir in Schlüsseltechnologien investieren wollen, dann sollten wir im Beihilferecht gezielt Spielräume schaffen – etwa indem europäische Produkte in der Wertschöpfungskette bevorzugt werden. Ich habe das bei den Energieeffizienzförderungen bereits vorgemacht: Dort gibt es erstmals einen Bonus, wenn die Produktion in Europa stattfindet – damit sind wir europaweit Vorreiter. So ein „Made-in-Europe“-Ansatz sollte auch in der öffentlichen Beschaffung stärker verankert werden, etwa im Infrastrukturbau oder bei Großprojekten, bei denen viel Stahl benötigt wird. Es geht darum, strategisch zu denken und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie aktiv zu sichern..
Die Stahlindustrie ist im hohen Maße energieintensiv und steht im internationalen Wettbewerb. Was kann man auf dieser Ebene gegen die hohen Energiepreise in Europa tun? Das Stromkosten-Ausgleichsgesetz (SAG), das energieintensiven Unternehmen einen Ausgleich für indirekte CO2-Kosten gewährt, ist in Österreich ja sehr knapp dimensioniert.
Im Laufe des Jahres 2022, also dem alten Industriestrombonus (SAG 2022), ist der Preis auf über 400 Euro pro Megawattstunde gestiegen, mittlerweile liegt er wieder bei 100 Euro pro Megawattstunde, also auf dem Niveau wie vor vier Jahren (Österreichischer Strompreisindex, ÖSPI Jahr). Der Industriestrombonus soll kurzfristig helfen und verfolgt zwei Ziele. Einerseits geht es um eine finanzielle Unterstützung für den Ausgleich der hohen Energiekosten und andererseits um einen klaren Anreiz, um in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren. Im Unterschied zum alten SAG gibt es beim Industriestrombonus eine Verpflichtung, in Energieeffizienzmaßnahmen zu investieren, weil das die billigste und beste Möglichkeit ist, um Energie zu sparen. Das ist eine schnelle Sofortmaßnahme, sobald sie vom Parlament beschlossen wird. Mittelfristig geht es darum, dass wir den Energiemarkt in Österreich reformieren – letzte Woche haben wir dazu die koalitionären Verhandlungen der Regierungsvorlage gestartet. In diesem Gesetz haben wir ein eigenes Paket für die energieintensive Wirtschaft geschnürt, was Power-to-Purchase-Agreements, Direktleitungen und Energiegemeinschaften für Unternehmen betrifft. Langfristig müssen wir schauen, dass sich die internationalen Märkte stabilisieren, insbesondere beim Gaspreis, der ja auch den Strompreis bestimmt. Hier müssen wir uns bei Lieferungen breit diversifiziert aufstellen.
Ein wichtiger Aspekt der Stahlstrategie der EU ist grüner Stahl. Ist grüner Stahl in dieser schwierigen Lage, in der sich die europäische Stahlindustrie befindet, wirklich der richtige Fokus? Grüner Stahl ist teurer – wer soll den kaufen?
Es braucht beides – kurzfristige Entlastung und langfristige Perspektiven. In einer Krise wie der jetzigen muss man handeln wie die Feuerwehr: schnell, gezielt und unbürokratisch. Genau das tun wir etwa mit dem Industriestrombonus, um die Energiekosten für die Unternehmen abzufedern.
Gleichzeitig dürfen wir die Zukunft nicht aus dem Blick verlieren. Grüner Stahl ist ein zentraler Baustein für die klimaneutrale Industrie von morgen. Natürlich ist er aktuell teurer, aber dafür braucht es gezielte Anreize und eine Nachfrage, etwa durch öffentliche Beschaffung oder über Branchen, die Wert auf nachhaltige Lieferketten legen. Das beste Beispiel ist das neue Voest-Werk, für das wir letzte Woche den Grundstein gelegt haben – ein Investitionsvolumen von 170 Millionen Euro. Das zeigt, dass unsere Industrie bereit ist, in innovative Prozesse zu investieren und sich an der Zukunft auszurichten. Aber sie braucht dafür die richtigen Rahmenbedingungen – kurzfristige Unterstützung und langfristige Planungssicherheit.
CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) würde eigentlich wie ein Zoll wirken, hat aber viele Schlupflöcher. Kann man die überhaupt effizient schließen?
Ich erwarte mir ganz klar von der EU-Kommission, dass diese Schlupflöcher geschlossen werden. Wenn ein Schutzmechanismus wie der CBAM mehr an Schweizer Käse als an echten Schutz erinnert, dann muss man grundsätzlich über die Wirksamkeit dieses Instruments nachdenken.
Ursprünglich wurde der CBAM entwickelt, um die höheren Produktionskosten durch Umweltauflagen in Europa auszugleichen. Das war auch richtig. Aber mittlerweile hat sich die Lage verändert: Wir haben es zusätzlich mit massiven globalen Überkapazitäten zu tun – insbesondere aus China. Deshalb wäre es klüger, den bestehenden CBAM weiterzuentwickeln, statt neue Schutzmechanismen zu erfinden. Wir sollten ihn an die neuen geoökonomischen Realitäten anpassen und so gestalten, dass er auch wirklich schützt – effektiv, durchsetzbar und ohne Hintertüren.
Wenn ein Schutzmechanismus wie der CBAM mehr an Schweizer Käse als an echten Schutz erinnert, dann muss man grundsätzlich über die Wirksamkeit dieses Instruments nachdenken.
Wolfgang Hattmannsdorfer
Der europäische Aktionsplan für die Stahlindustrie vom März soll die EU-Mitgliedstaaten ermutigen, Energiesteuern flexibler zu gestalten sowie reduzierte Netztarife anzubieten. Kann dafür Spielraum geschaffen werden in Österreich?
Es ist auf jeden Fall positiv, dass die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten in diese Richtung ermutigt. In Österreich setzen wir bereits Maßnahmen um – etwa mit dem Industriestrombonus, der gezielt energieintensive Unternehmen entlastet. Auch im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz greifen wir genau dieses Thema auf, insbesondere die Frage, wie wir die Netzkosten für die Industrie langfristig in den Griff bekommen. Aber ich appelliere auch an die Europäische Kommission: Es darf nicht bei Strategien und Papiertigern bleiben. Unsere Industrie braucht konkrete, wirksame Maßnahmen, die rasch umgesetzt werden und echte Unterstützung bringen. Nur so können wir die Wettbewerbsfähigkeit sichern und den Standort Europa stärken.