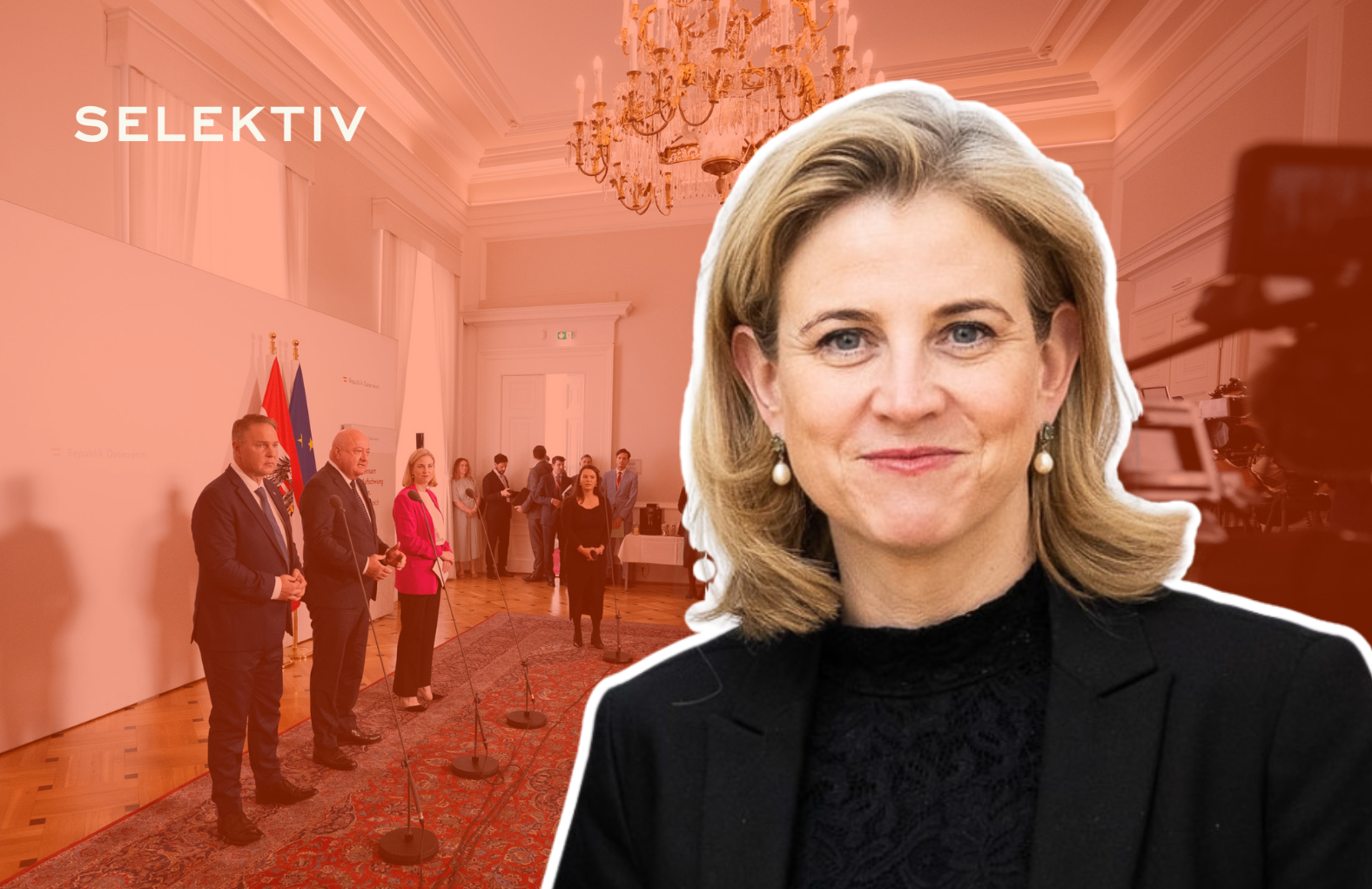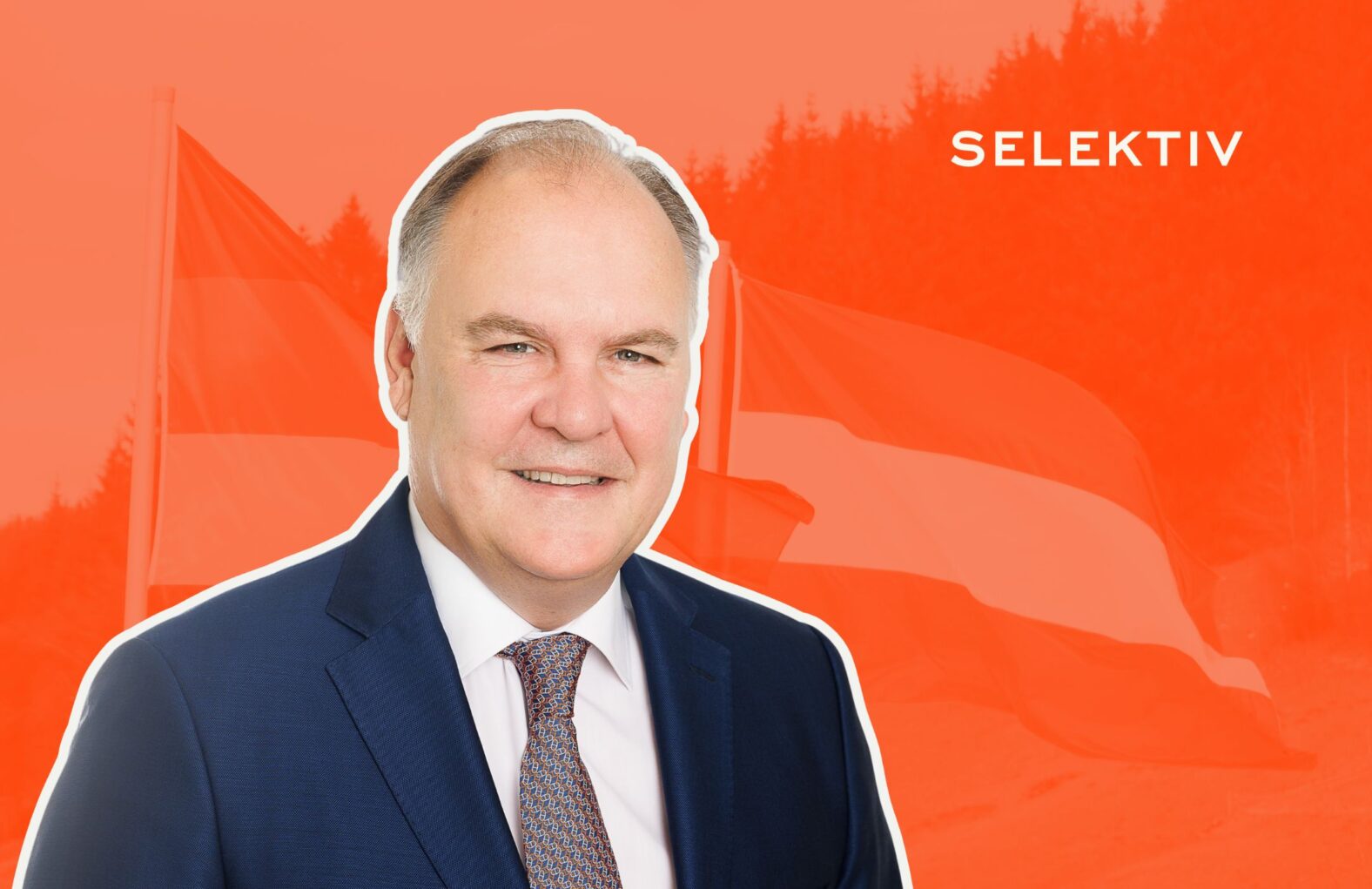Regierung und Gewerkschaft sind am 16. September zur ersten Verhandlungsrunde zu den Beamtenlöhnen zusammengekommen. Im Raum steht ein Aufschnüren des bereits vergangenes Jahr fixierten Abschlusses für 2026. Vereinbart ist, dass die Löhne und Gehälter kommendes Jahr um 0,3 Prozentpunkte über der Inflation, also voraussichtlich um 3,3 Prozent, erhöht werden. Aufgrund der anhaltend schwierigen Budgetsituation und der schlechten wirtschaftlichen Lage, soll das neu verhandelt werden. Die Symbolkraft des Abschlusses im öffentlichen Dienst ist auch für die laufenden Herbstlohnrunden im privaten Bereich groß, bestätigt Ökonom Johannes Berger. „Natürlich geben Lohnabschlüsse in einem Bereich mit vielen Beschäftigten eine gewisse Richtung vor. Gleichzeitig sind öffentlicher und privater Bereich auch bis zu einem gewissen Grad Konkurrenten beim Anwerben von Arbeitskräften“, so Berger.
Gestern gab es die erste Gesprächsrunde zu den Beamtenlöhnen. Ergebnis gibt es noch keines, aber der GÖD zeigt sich verhandlungsbereit. Was würde ein Aufschnüren des Beamtenabschlusses für 2026 bringen?
Johannes Berger: Sehen wir uns zuerst die Ausgangslage an. Wir haben zum einen eine schwierige Situation bei den öffentlichen Finanzen – hohe Defizite, eine steigende Verschuldung. Bei den öffentlichen Ausgaben liegen wir 2024 auf Platz 3 in der EU und deutlich über dem EU-Schnitt. Die Ausgabenquote wird in den kommenden Jahren zwar etwas zurückgefahren, liegt aber noch immer weit über dem Vorkrisenniveau. Wir werden auch trotz der Bemühungen weiterhin hohe Defizite haben. Gleichzeitig haben wir eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben eine hohe Inflation, ein geringes Wirtschaftswachstum, einen starken Anstieg der Lohnstückkosten und eine rückläufige Wettbewerbsfähigkeit. Anders als bei den Krisen zuvor, haben wir diesmal in Österreich schlechtere Zahlen als in den meisten anderen EU-Ländern.
Anders als bei den Krisen zuvor, haben wir diesmal in Österreich schlechtere Zahlen als in den meisten anderen EU-Ländern.
Johannes Berger
Die Ausgangssituation ist also schwierig und deshalb ist eine Neuverhandlung notwendig?
Ja, weil es einen großen Konsolidierungsbedarf gibt, besteht die Notwendigkeit, bei großen Ausgabenkategorien Schritte zu setzen. Das sollten Maßnahmen sein, die gleichzeitig möglichst wenig das Wirtschaftswachstum oder die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen bzw. die Inflation anheizen. Da bieten sich moderate Beamtenabschlüsse oder eine moderate Pensionsanpassung aus ökonomischer Sicht an.
Ein höherer Beamtenabschluss würde also die Inflation anheizen?
Die Frage ist, was die Alternative ist, um den Konsolidierungsbedarf zu decken. Wenn diese Alternative z. B. Steuererhöhungen sind, dann würden diese die Inflation weiter erhöhen. Gleichzeitig hat der Beamtenabschluss mitunter indirekte Effekte auf den privaten Bereich.
Welche Symbolkraft erwarten Sie vom Abschluss im öffentlichen Dienst für die ebenfalls derzeit laufenden Herbstlohnrunden im privaten Bereich?
Natürlich geben Lohnabschlüsse in einem Bereich mit vielen Beschäftigten eine gewisse Richtung vor. Gleichzeitig sind öffentlicher und privater Bereich auch bis zu einem gewissen Grad Konkurrenten beim Anwerben von Arbeitskräften. Für die Unternehmen könnte ein hoher Beamtenabschluss also entweder Druck bedeuten, ebenfalls hoch abschließen zu müssen oder der öffentliche Bereich wird relativ betrachtet attraktiver.
Wie interpretieren Sie die Entwicklung, dass die Beschäftigung im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist und – natürlich aufgrund der schwachen Industriekonjunktur – die Beschäftigung in der Industrie gesunken ist? Was bedeutet das volkswirtschaftlich für Österreich?
Einerseits müssen die Gehälter dieser öffentlichen Bediensteten ja irgendwie finanziert werden. Zu einem wesentlichen Teil kommt diese Finanzierung vom privaten Sektor. Die Finanzierung wird natürlich schwieriger, wenn es eine Verschiebung vom privaten Bereich in den öffentlichen Sektor gibt. Andererseits geht eine sinkende Beschäftigung in der Industrie bzw. im privaten Sektor allgemein damit einher, dass weniger produziert wird. Dadurch sinkt das Angebot und das kann etwa zu Verzögerungen bei Dienstleistungen im Gewerbe führen oder zu Preiserhöhungen und zu steigender Inflation.
2027 und 2028 sind im öffentlichen Dienst Nulllohnrunden geplant. Davon muss die Regierung möglicherweise in den Verhandlungen abweichen, um ein Aufschnüren des 2026er-Abschlusses zu ermöglichen. Was würde das bedeuten?
Das könnte dazu führen, dass wir den geringeren Lohnabschluss auf das nächste Jahr vorziehen und uns dann auch 2026 ein bisschen Kosten ersparen würden. Das Vorziehen hilft natürlich, dass wir uns schon 2026 Geld ersparen. Mindestens ebenso wichtig wäre aber, dass man die strukturellen Herausforderungen angeht. Nur weil wir in einem Jahr moderate Abschlüsse haben, heißt das ja nicht, dass wir die Herausforderungen bei den öffentlichen Finanzen im Griff haben.
Bei den privaten KV-Abschlüssen wurde zusätzlich zur Benya-Formel bereits punktuell die wirtschaftliche Situation einzelner Unternehmen berücksichtigt. Gibt es eine Möglichkeit, das auch im öffentlichen Bereich zu tun?
In der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wird die Produktivität der Beamten über die Kosten gemessen. Das heißt, es gibt nicht wirklich ein Produktivitätsmaß im öffentlichen Dienst.
Es gibt nicht wirklich ein Produktivitätsmaß im öffentlichen Dienst.
Johannes Berger
Schade. Gibt es keine Messgröße, um die man die rollierende Inflation ergänzen könnte, um bei den Abschlüssen auch die wirtschaftliche Realität des Landes abzubilden?
Einerseits müsste man die öffentlichen Finanzen berücksichtigen – was kann oder will sich der Staat leisten? Andererseits sind der öffentliche und private Sektor in diesem Fall kommunizierende Gefäße. Wenn es im privaten Bereich Lohnzurückhaltung gibt, weil die wirtschaftliche Situation schwierig ist, spricht einiges dafür, auch im öffentlichen Bereich zurückhaltend zu sein.
Wie stark belastet die Erhöhung der Beamtenlöhne das Budget bzw. wie groß ist das Sparpotenzial. Kolportiert wird, dass ein Prozentpunkt Plus für die Beamten in etwa 190 Millionen Euro kostet.
Die Abgrenzung ist schwierig: Für wen gelten die Abschlüsse? Nur für den Bund oder auch für die Länder, Gemeinden, ausgegliederte Einheiten usw.? Der Fiskalrat schreibt in einer Analyse vom Vorjahr, dass es bei einem um einen Prozentpunkt niedrigeren Abschluss ein Sparpotenzial von 0,2 Mrd. Euro bei „öffentlichen Beschäftigten Bund“ und 0,6 Mrd. Euro bei „öffentlichen Beschäftigten Gesamtstaat“ geben würde. Das verdeutlicht, dass etwa ein Nachziehen der Länder beim Abschluss des Bundes spürbare Effekte hätte.