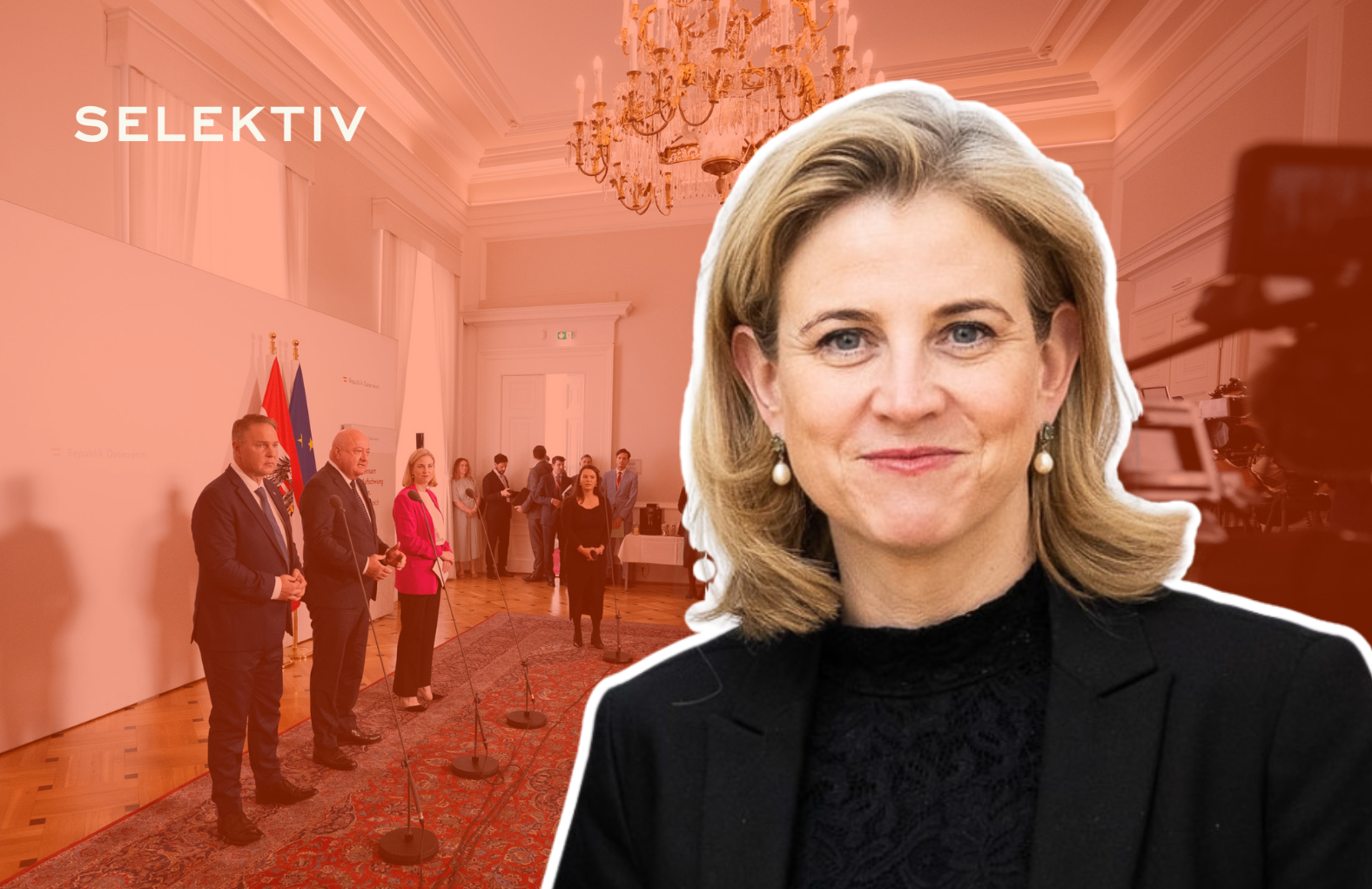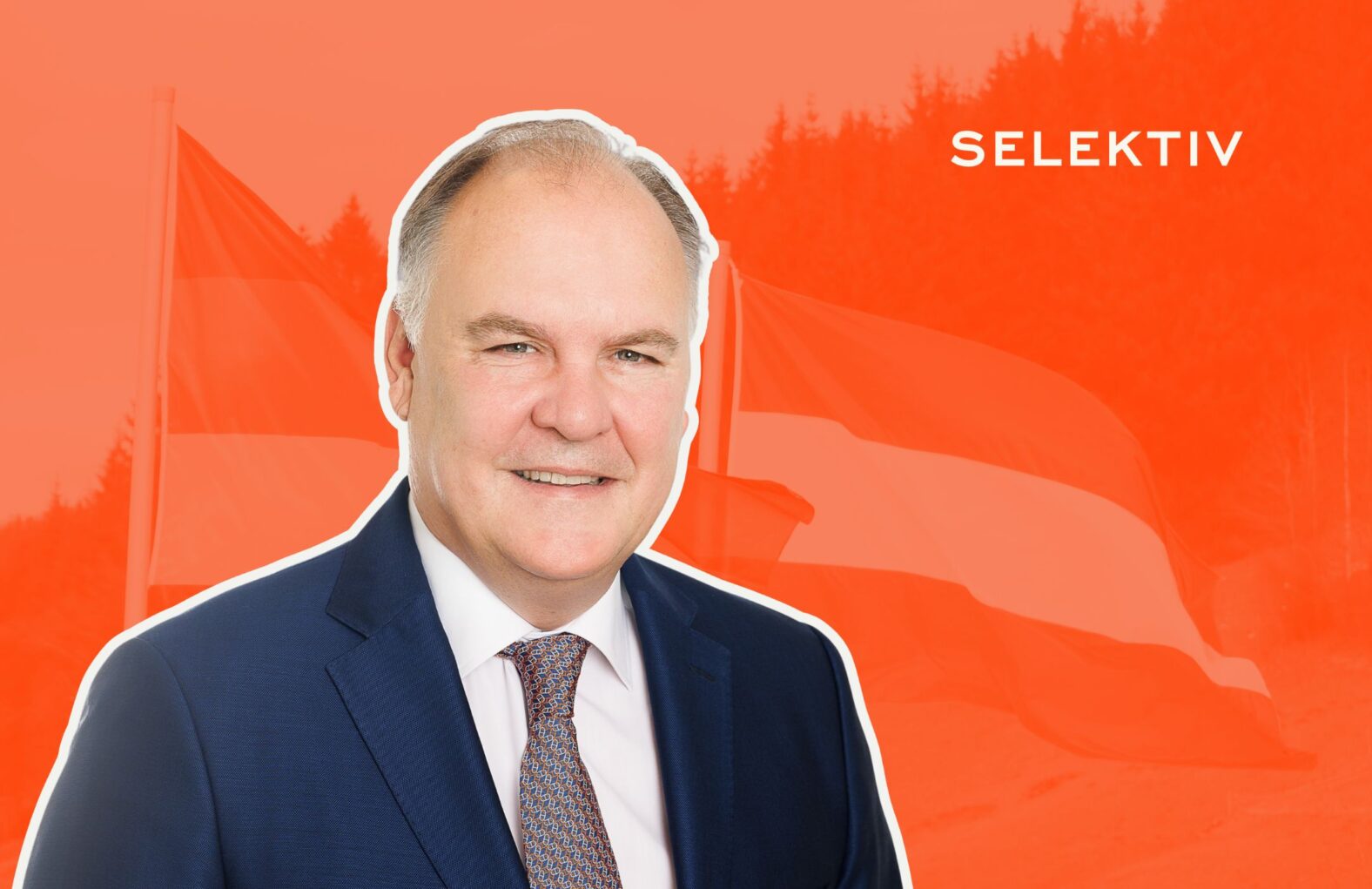EcoAustria hat seinen Competitiveness Index mit Daten des 1. Halbjahrs 2025 aktualisiert. Österreich liegt im EU-Vergleich auf Platz 20 von 27, im 3. Quartal 2024 war es noch Platz 16 und 2021 sogar noch Platz 12. Im 1. Halbjahr 2025 hat sich der Abwärtskurs zwar eingebremst, aber Studienautor Nikolaus Graf rechnet mit einem erneut schwächeren 2. Halbjahr. Die Entwicklung sei in allen drei Indikatoren beunruhigend: Exporte, Investitionen und Produktivität. „Wenn wir beim Statusquo bleiben, wird auch die Deindustrialisierung weitergehen“, so Graf.
Im neuen Competitiveness Index von EcoAustria gibt es nach einem deutlichen Abstieg wieder eine gewisse Stabilisierung. Welchen Zeitraum betrifft diese und wodurch hat sie sich ergeben?
Nikolaus Graf: Der EcoAustria Competitiveness Index ECI betrachtet die quartalsweise Veränderung zu 2017 in den Bereichen Exporte, Anlageninvestitionen und Arbeitsproduktivität. Die Veränderung betrachten wir im Vergleich zu vergleichbaren EU-Ländern. Die Entwicklungen liefern uns Hinweise zu Veränderungen von Wettbewerbsfähigkeit. Ab 2017 gab es eine zögerliche Aufwärtsdynamik, dann ab 2020 einen stabilen Seitwärtslauf und ab Ende 2022 gehen diese Indikatoren nach unten. Ab 2023 entwickeln wir uns auch schlechter als der Durchschnitt und der Median der EU-27-Länder.
Und nun hat eine gewisse Stabilisierung eingesetzt, es geht also zumindest nicht mehr weiter bergab?
Wichtig ist, dass wir nicht in der Lage waren, diese Verschlechterung seit 2023 zu kompensieren. Die Stabilisierung hat sich im 1. Halbjahr eingestellt und das deckt sich im Wesentlichen auch mit den Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Allerdings sind die Herbstquartale in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt und ich würde vermuten, dass es in der zweiten Jahreshälfte wieder in Richtung Seitwärtsbewegung geht. Bei den Exporten erwarte ich jedenfalls keine Dynamik.
Welcher der Indikatoren Exporte, Investitionen und Produktivität ist besonders beunruhigend?
Zunächst einmal die Exporte. Österreich war immer eine außenwirtschaftlich aktive und erfolgreiche Volkswirtschaft. Seit Anfang 2024 entwickelt sich das Volumen der Nettoexporte inflationsbereinigt beunruhigend negativ. Auch die Bruttoexporte und Bruttoimporte stagnieren, was auf eine gewisse globale Abkühlung hindeutet. Dass allerdings die Nettoexporte, also die Exporte minus der Importe, sinken, deutet auf strukturelle Probleme in Österreich hin. Ebenfalls problematisch ist die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Grundsätzlich gibt es hier historisch eine strukturell positive Entwicklung in Österreich. Es war zwar nicht mehr wie in den 1970ern, dass uns die Arbeitsproduktivität phasenweise davon galoppiert, aber die Entwicklung war auch danach stabil. Seit Ende 2022 ist diese Entwicklung umgebrochen. Das ist auffällig für die österreichische Volkswirtschaft, dass die Arbeitsproduktivität über diesen langen Zeitraum bis 2025 sinkt.
An was kann man dieses Produktivitätsminus festmachen?
Technisch ist die Arbeitsproduktivität definiert als volkswirtschaftlicher Output, also das BIP, durch den Arbeitseinsatz, also die gearbeiteten Stunden. Das BIP stagniert seit Längerem bestenfalls, das geleistete Arbeitsvolumen ist aber relativ konstant. Dadurch ergibt sich, dass der Quotient dieser Division nicht steigen kann. Die Frage ist, warum das über diesen Zeitraum so lange passiert. Der erste Grund ist, dass wir beim BIP nicht vorankommen. Hier gilt es, das Arbeitsvolumen in seiner Effizienz und Produktivität zu steigern. Das kann aus meiner Sicht nur dann gelingen, wenn die Effizienz gesamtwirtschaftlich steigt, und das entsteht durch die Nutzung von Technologien und Innovationen. Die Innovationsdynamik und die Marktfähigkeit dieser Innovationen sind wichtige Stellhebel für die Produktivität.
Lässt sich anhand Ihrer Daten eine Deindustrialisierung ablesen?
Die Deindustrialisierung lässt sich am sinkenden Wertschöpfungsanteil des Produktionssektors ablesen. Betrachtet man Rahmenbedingungen industrieller Wertschöpfung, so wird es der Industrie nicht immer leicht gemacht. Wir hoffen, dass die Industriestrategie einen Ansatz bietet, den Kurs wieder zurechtzurücken. Wenn wir beim Status quo bleiben, wird auch die Deindustrialisierung weitergehen.
Welche Erwartungen haben Sie an die Industriestrategie? Der Prozess ist sehr breit aufgestellt – könnte da am Ende nicht nur der kleinste gemeinsame Nenner herausschauen?
Ich kenne den Stand der Ausarbeitung nicht. Der kleinste gemeinsame Nenner wäre jedenfalls eine sehr pessimistische Erwartung. Wenn diese Strategie nur ein Sammelsurium an Einzelmaßnahmen wird, die ohnehin umgesetzt worden wären, dann wird das kein substanzieller Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der politikfeldübergreifend wirkt. Die wesentlichen Themen sind: die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Die Abgabenquote ist hoch. Der zweite Punkt sind die Energiekosten, gerade für die energieintensiven Produzenten Österreichs sind diese maßgeblich für die Durchsetzungsfähigkeit. Und der dritte Punkt: die Lohnentwicklung. Man muss aber auch über diese unmittelbaren Faktoren preislicher Wettbewerbsfähigkeit hinausdenken, Richtung Regulierung und Effizienz des öffentlichen Sektors oder Innovations- und Unternehmensdynamik. Der vierte Punkt wäre die Effizienz am Arbeitsmarkt und die Bereitstellung von Qualifikationen.
Sie haben die Abgabenquote angesprochen. Die ist sogar sehr hoch, politisch scheint eine Senkung derzeit aber unrealistisch. Sollte sie doch passieren, wo müsste man beginnen?
Ich kann keine politischen Entscheidungen treffen, aber natürlich haben wir bei EcoAustria Ideen dazu. Die Abgabenquote ist ein maßgeblicher Kostenbestandteil und hemmt die Durchsetzungsfähigkeit. Man müsste den öffentlichen Sektor systematisch nach Effizienzpotenzialen durchforsten: Sozialstaat, Gesundheit, Bildung, Föderalismus, Verwaltung und Bürokratie. Dass die Staatsquote hoch ist, heißt, dass die öffentliche Hand sehr viel Geld ausgibt. Das ist einerseits negativ, weil es zu einer hohen Abgabenquote führt. Auf der anderen Seite hat die Bezugsgröße, an der wir Effizienzpotenziale festmachen können, ein hohes Volumen. Nur muss man bereit sein, die erforderlichen Strukturreformen durchzuführen. Das muss Gegenstand einer mittelfristigen, ganzheitlichen Industriestrategie sein.