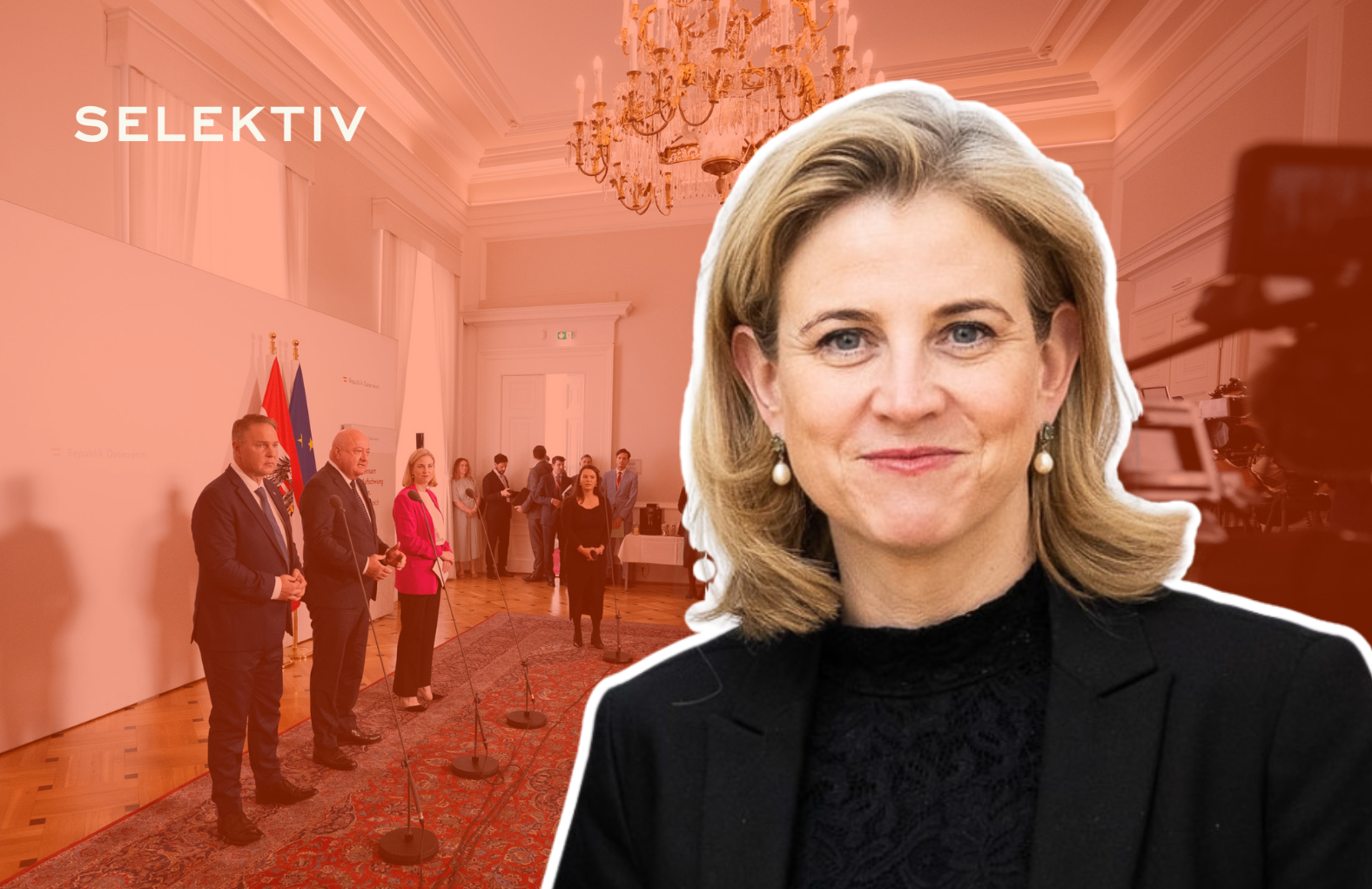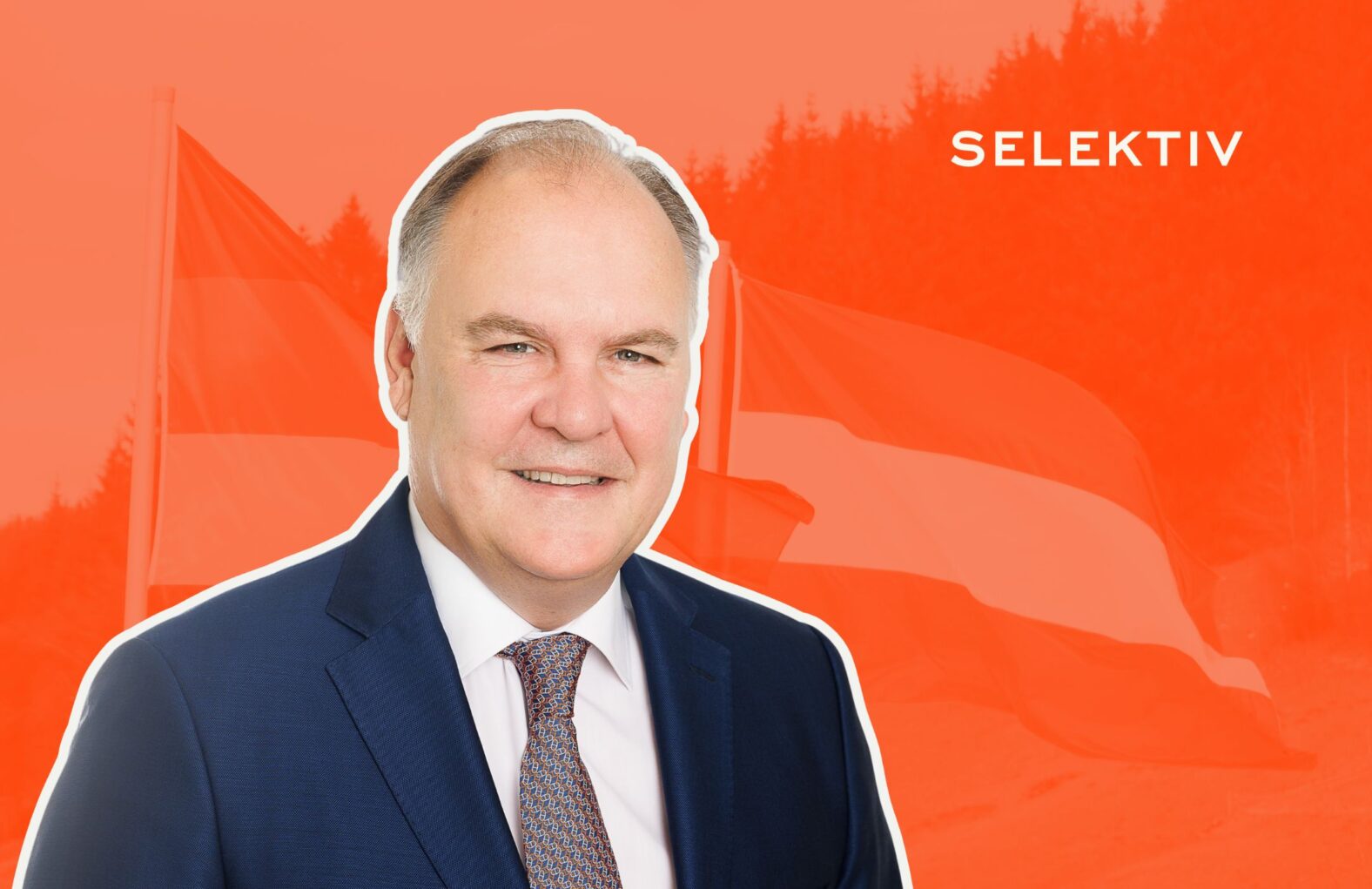1.000 österreichische Firmen sind in den USA tätig, das seien „uncharakteristisch“ viele, sagt Peter Hasslacher, österreichischer Wirtschaftsdelegierter und Chef des Advantage Austria USA Büros in New York. Im Interview mit Selektiv spricht er über die von Donald Trump angekündigten Zölle, der Bedeutung der USA für Österreichs Außenwirtschaft und verrät, was wir uns von den USA abschauen sollten.
Können Sie ob der täglichen Ankündigungen von Zöllen und einer wahren Flut an präsidentiellen Dekreten derzeit noch den Überblick behalten? Machen Sie sich Sorgen oder sind Sie noch entspannt?
Peter Hasslacher: Meine These war, ist und bleibt, dass es in den USA ums Geschäft geht. Viele oder fast alle Ankündigungen von Donald Trump sind innenpolitisch getrieben. Wir machen ein super Geschäft mit den USA und in den USA. Da sehe ich vorerst auch keine großen Änderungen aufkommen. Aus österreichischer Sicht ist es gut, wenn in den USA dereguliert wird, wenn Steuern gesenkt werden, wenn es weniger Vorschriften gibt und man leichter zu Genehmigungen kommt. Das sind durchaus positive Neuigkeiten.
Die Zölle gegenüber Mexiko und Kanada werden vorerst ausgesetzt. Jene gegen China sind in Kraft getreten. Auch die EU wird mit Zöllen belegt werden, so Trump. Wird es Ihrer Meinung nach bei einer Ankündigung bleiben, oder werden diese Zölle tatsächlich eingehoben werden?
Es ist immer noch offen, ob die angekündigten Zölle bald eingeführt werden. Das ist jetzt erst mal eine Ansage. Was dann wirklich passieren wird, wird man sehen. Auch die Höhe der Zölle ist noch unklar. Trump ist ein Deal-Maker mit einem 360-Grad-Zugang. Vielleicht sollte man darauf Rücksicht nehmen. Damit geht auch ein Paradigmenwechsel einher, der sicher eine Herausforderung ist – geeintes und entschlossenes Auftreten der EU hilft sicher. Die Beispiele von Kanada und Mexiko zeigen, dass auch Kommunikation und Verständnis für die innenpolitische Situation in den USA helfen können.
Wie sieht denn die Resonanz österreichischer Unternehmen auf die angedrohten Zölle aus? Sehen diese auch die zuvor erwähnten positiven Aspekte oder reagiert man verschreckt auf diese Drohungen?
Wir sehen beides. In den USA sind ungefähr 1.000 österreichische Firmen vertreten. Auf der einen Seite haben diese Firmen durch zum Beispiel eine weitere Liberalisierung von Vorschriften einen Vorteil. Auf der anderen Seite haben wir viele exportorientierte Unternehmen, diese leiden unter der Unsicherheit bezüglich der angekündigten Zölle. Denn Unsicherheit ist für jedes Geschäft schlecht. Solange diese Drohungen im Raum stehen, leidet die Planungssicherheit. Ich würde die Stimmung unter den österreichischen Unternehmen also als ambivalent bezeichnen.
Wie viele der 1.000 österreichischen Firmen produzieren denn bereits in den USA – und könnten das aufgrund der angedrohten Handelsbarrieren noch mehr werden?
Von den 1.000 österreichischen Unternehmen produziert ungefähr ein Drittel in den USA, das ist ein uncharakteristisch hoher Anteil. Dieser Anteil dürfte auch noch weiter ansteigen, denn viele sehen „America First!“ als Aufruf, noch mehr an lokaler Produktion und Wertschöpfung zu generieren. Das ist aber nicht erst seit der Wiederwahl Trumps so, sondern die Reindustrialisierung läuft bereits seit Jahren wieder an. Trump ist nur ein Brennglas für viele Trends – dieses Brennglas fokussiert und beschleunigt eben gewisse Entwicklungen, so auch diese.
Das heißt, österreichische Unternehmen könnten eigentlich sogar von Trumps Absichten, traditionelle Industrie wie z.B. Autohersteller zu fördern und zurück in die USA zu holen, profitieren?
Die klassischen österreichischen Export-Stärken liegen im Bereich Maschinen, Anlagensteuerung und Produktionstechnologie. Drei Viertel unserer Exporte werden im Bereich High-Tech erzielt. Wenn Trump jetzt in diesen Bereichen mehr Produktion vor Ort generieren will, kann das österreichischen Unternehmen auch helfen. Mehr Produktion vor Ort bedeutet mehr Steuerungsanlagen und das dazugehörige Know-how. Dieses Know-how kommt eben sehr oft aus Europa – in den USA ist das über Jahrzehnte hinweg verlorengegangen. Hier haben wir also noch einen Wettbewerbsvorteil, der uns in dieser Situation zugutekommen kann.
Wenn Sie jetzt den europäischen Wettbewerbsvorteil herausheben, täuscht dann der Eindruck vom Wirtschaftsstandort USA, der so viel attraktiver und kompetitiver als der europäische wäre?
Wettbewerbsvorteile und Standortattraktivät muss man trennen. Wir glauben immer, bei den USA handle es sich um ein Land des High-Tech – das stimmt aber nur bis zu einem gewissen Grad. Im Bereich der Häfen und der Logistiksysteme sind die USA technologisch in den 70er oder 80er Jahren steckengeblieben. Man kann sich kaum vorstellen, dass in dem Land, das Amazon hervorgebracht hat – also den Logistik-Dominator der westlichen Welt schlechthin – noch per Hand Strichlisten geführt werden, um Lagerstände zu erfassen. Es gibt in den USA ein paradoxes Nebeneinander des global agierenden High-Tech-Sektors und enorm ineffizienten Bereichen, wie eben zum Beispiel in den Häfen.
Die ganze Welt ist globalisiert, außer den USA.
Auch ist die US-Wirtschaft relativ wenig globalisiert. Was Güter betrifft, haben die USA eine extrem niedrige Exportquote von 10-13 Prozent. Zum Vergleich: Österreich hat eine Exportquote von 60 Prozent, Slowenien von 80 Prozent. Man könnte sagen: Die ganze Welt ist globalisiert, außer den USA. Viele US-Sektoren sind dem internationalen Wettbewerb also bedingt oder gar nicht ausgesetzt.
Was die Standortattraktivät betrifft, sieht es natürlich ganz anders aus. Der erste Faktor ist die Verfügbarkeit von Kapital, es gibt eine unglaubliche Marktdynamik und eine große, sehr kaufkraftstarke sowie noch weiter wachsende Bevölkerung. Das ist ein Multiplikator, den man gar nicht überschätzen kann. Märkte von vergleichbarer Größe gäbe es nur in China oder Indien – dort ist die mangelnde Rechtsstaatlichkeit aber wieder ein Problem. In den USA hingegen gibt es gesicherte Rahmenbedingungen und man kommt auch sehr schnell zu seinem Recht. Weiters ist der Zugang zu Genehmigungen in den USA viel leichter. Auch die Energiepreise sind um ein Multiples geringer als bei uns.
Was könnte sich Österreich von den genannten Faktoren abschauen, um die eigene Standortattraktivität zu verbessern?
Ein wichtiger Punkt – der auch nicht unbedingt etwas mit Donald Trump zu tun hat – ist, dass die Amerikaner zutiefst pragmatisch sind. So sind die USA in den letzten 10 bis 15 Jahren von einem der größten Energie-Importeure zum größten internationalen Exporteur von Energie geworden. Auch wurden kürzlich große Lithium-Vorkommen in Nevada gefunden und ich bin überzeugt davon, dass die USA in zehn Jahren einer der größten Lithium-Produzenten der Welt sein werden. Dieser Pragmatismus – das Beste aus den vorhandenen Ressourcen zu machen – zieht sich eigentlich überall durch und kommt auch in „Make America Great Again“ zum Ausdruck. Das kann für Österreich eine Inspiration sein. Wir müssen jetzt nicht ganz Europa aufgraben und nach Bodenschätzen suchen, aber sollten uns in gewissen Bereichen diesen Pragmatismus von den USA abschauen.
Mein Friseur in New York gibt mir Aktientipps.
Auch beim Kapitalmarkt – wahrscheinlich einer der größten US-Wettbewerbsvorteile – müssen wir uns etwas abschauen. Dieser wurde über mittlerweile ein Jahrhundert aufgebaut und hat Effekte, die uns ins Staunen versetzen. Zum Beispiel gibt mir mein Friseur hier in New York Aktientipps. Ich weiß nicht, ob Sie in Wien einen Friseur haben, der Ihnen Aktientipps gibt.
Europa muss darüber nachdenken, wie man einen europäischen Kapitalmarkt schaffen könnte, um die Wirtschaft besser zu finanzieren, um Startups besser zu finanzieren und um Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Neben dem Pragmatismus spielt auch die „Macher-Mentalität“ der USA eine Rolle. Das beste Beispiel ist derzeit wohl Künstliche Intelligenz. Die Amerikaner machen einfach, die Chinesen auch – und die Europäer regulieren.
Stichwort China: Welche Auswirkungen könnte ein Handelskrieg zwischen den USA und China auf Österreich haben?
Österreich hat den Vorteil, relativ wenig direkt nach China zu exportieren. Wir exportieren ungefähr gleich viel nach China wie nach Slowenien – und Slowenien ist dann doch ein etwas kleinerer Markt als China. Indirekt ist Österreich über deutsche Exporte als Zulieferer doch etwas stärker in die Exporte nach China involviert, aber der Export nach China wird eher noch weniger werden. Umgekehrt wird China eher noch mehr nach Europa exportieren, um ihre Überschüsse und Produktionsüberkapazitäten loszuwerden.
Auf der anderen Seite sind eben die USA, wo wir jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten erzielen und auch den weltweit größten Handelsbilanzüberschuss haben. Konträrer könnte es also eigentlich gar nicht sein. Da stellt sich die Frage, wie man mit diesem globalen Paradigmenwechsel umgeht.
Diese Frage greife ich gerne auf, wie geht man mit dem globalen Paradigmenwechsel um?
Als kleines Österreich können wir uns nicht separat positionieren. Diese Frage muss auf europäischer Ebene beantwortet werden. Wie bereits erwähnt, hat Europa noch gewisse Wettbewerbsvorteile. Noch können wir Qualität produzieren. Europa steht für High-Tech und High-Quality, hier müssen wir uns noch stärker positionieren. Inspiriert vom amerikanischen Pragmatismus müssen wir gewisse Barrieren über Bord werfen. Das ist der Ruf der Zeit, dem wir uns stellen müssen.
„Make America Great Again“ ist erstmal eine Ansage, aber ob diese wirklich von Erfolg gekrönt sein wird, ist noch nicht ausgemacht. Vorerst werden wir unsere Wettbewerbsvorteile in Europa weiterhin haben und auch nutzen können.