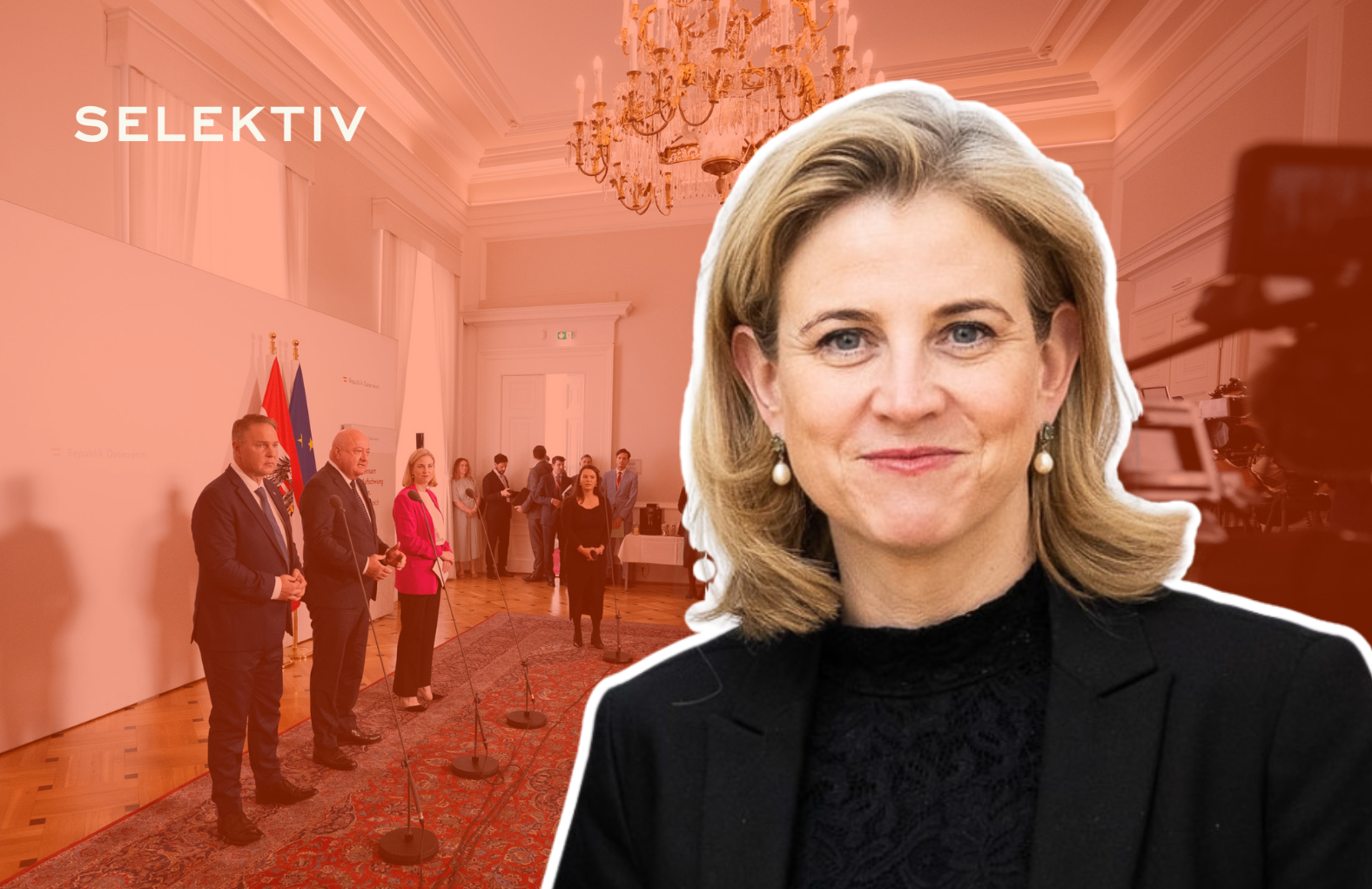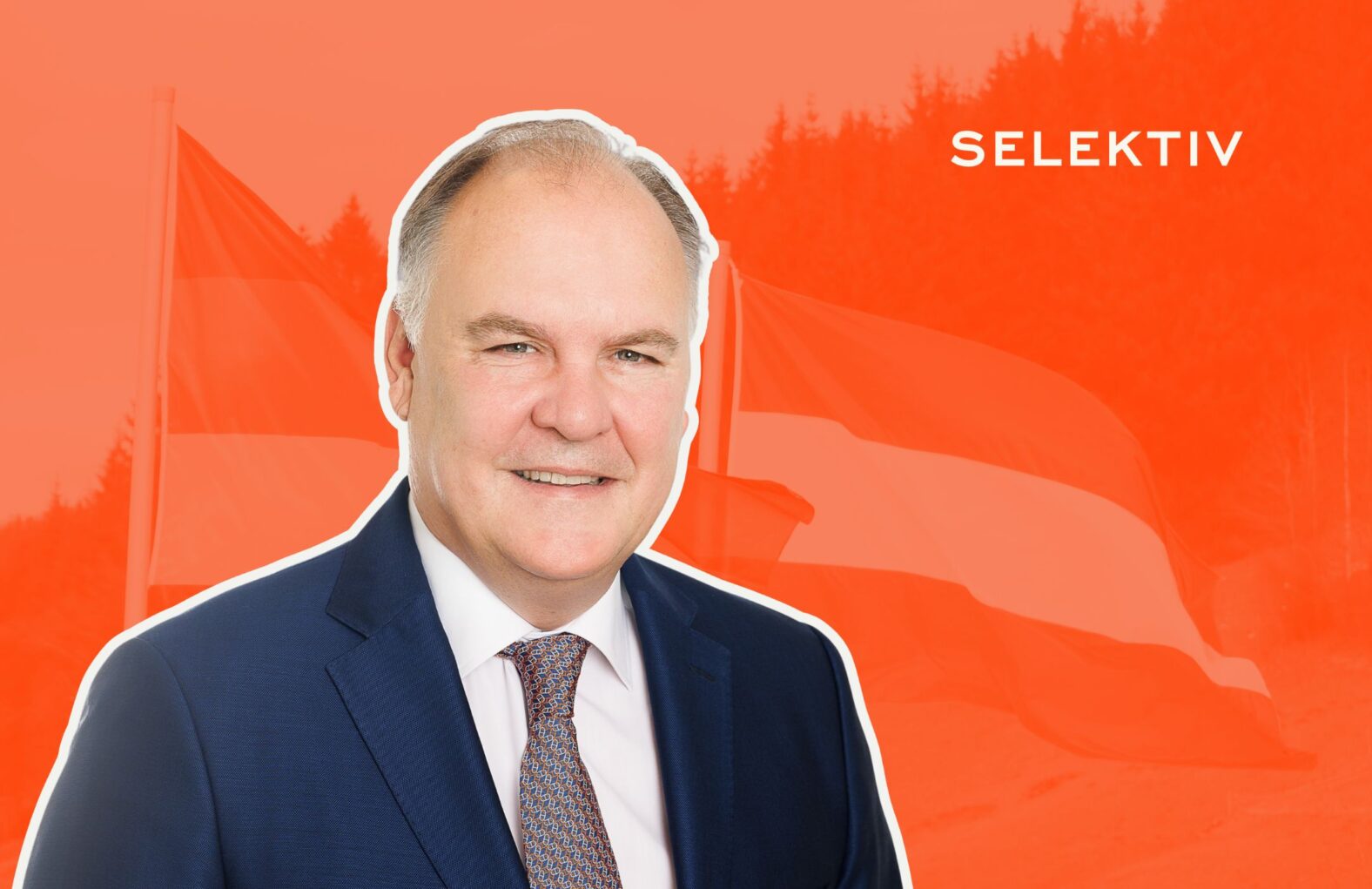Europäische Autohersteller geraten immer mehr unter Druck und das belastet auch die österreichische Zulieferindustrie. „Die Arbeitslosigkeit in der Herstellung von Kraftwagen und -teilen stieg von 2023 bis 2024 um 45 Prozent, was doppelt so hoch ist wie im allgemeinen Manufacturing-Sektor und vierfach so hoch wie in der Gesamtwirtschaft“, sagt Industrie-Experte Stefan Rathausky. Er sieht vor allem in der Europa-Zentrierung der Zulieferer ein Problem.
Die Automobilindustrie ist in Europa stark unter Druck geraten – insbesondere in Deutschland. Wie geht es der österreichischen Zulieferindustrie damit?
Stefan Rathausky: Die Branche in Österreich mit ihren über 900 Unternehmen und mehr als 80.000 Beschäftigten erlebt gerade ihre größte Belastungsprobe. Die Absatzrückgänge deutscher Fahrzeughersteller wie Mercedes und VW haben die Auftragsbestände bereits seit Mitte 2023 unter das langjährige Mittel gedrückt. Die österreichischen Automobilzulieferer stehen dadurch unter erheblichem Druck. Zum einen schlagen die generellen Probleme der Automobilhersteller voll auf die Zulieferer durch. Zum anderen ist die Exportabhängigkeit der österreichischen Unternehmen hoch – vor allem von der deutschen Automobilindustrie, wohin mehr als 60 Prozent der Exporte gehen – das wird zunehmend zur Achillesferse. Damit ist die österreichische Automobilbranche als eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft einem nicht unerheblichen Risiko ausgesetzt.
Können Sie das beziffern? Wie viele Betriebe mussten bereits zusperren und welche Auswirkungen hat das auf die Beschäftigung in dem Sektor?
Im Jahr 2024 gab es in Österreich insgesamt rund 5.000 Unternehmensinsolvenzen, ein Anstieg von fast 25 Prozent im Vergleich zu 2023. Die Anzahl der Insolvenzen bei den Zulieferern nimmt zu, hat sich allerdings bisher in Grenzen gehalten. Die Arbeitslosigkeit in der Herstellung von Kraftwagen und -teilen stieg von 2023 bis 2024 um 45 Prozent, was doppelt so hoch ist wie im allgemeinen Manufacturing-Sektor und vierfach so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Das zeigt nochmals deutlich, unter welchem Druck die Branche steht. Man muss somit kein Prophet sein, um für 2025 einen Anstieg bei Insolvenzen und Arbeitslosigkeit vorherzusagen. Besonders betroffen sind dabei Zulieferer, die stark von deutschen Herstellern abhängig sind.
Wie steht es angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation und dem trüben Ausblick um die Investitionsbereitschaft?
Um zu investieren, muss ich entweder Eigen- oder Fremdkapital haben oder Cashflow generieren. Der operative Cashflow als Anteil am Umsatz hat sich seit 2019 mehr als halbiert, was die Investitionsfähigkeit stark einschränkt. Konkret sind auch die Eigenkapitalstrukturen massiv geschrumpft, während der Anteil an Fremdkapital seit 2019 um 38 Prozent gestiegen ist. Unternehmen müssen mittlerweile 40 Prozent ihres EBT (Ergebnis vor Steuern) für Zinsen aufbringen. Und ob Eigentümer hier aktiv Eigenkapital zuschießen, sei dahingestellt. Alles in allem machen es diese Entwicklungen für viele Unternehmen schwierig zu investieren, obwohl dies für die Zukunftssicherung unerlässlich ist.
Ist das Tal bereits durchschritten oder kommt da noch etwas auf uns zu?
Die Aussichten für das laufende Jahr sind nicht gerade rosig. Es gibt jedoch Hebel, die die österreichischen Zulieferer auf Kosten- und Absatzseite in Bewegung setzen können, um die aktuelle Lage bestmöglich zu manövrieren. Startpunkt ist die Sicherung der Liquidität. Es ist wichtig, frühzeitig mit Banken und Investoren zu kommunizieren, um mögliche Finanzierungslücken zu schließen. Ebenso braucht es ein stringentes Kostenmanagement und die Nachverhandlung bestehender Kundenverträge, dort wo das gerechtfertigt ist. Kostenseitig sollten wirklich alle Hebel gezogen werden, um sich Spielraum – auch für Investitionen – zu verschaffen. Es darf keine heiligen Kühe mehr geben. Auf der Absatzseite gibt es im Grunde zwei wesentliche Hebel: die Absatzmärkte zu diversifizieren und in Innovationen zu investieren. Zahlreiche Zulieferer sind heute nicht mehr nur auf die Automotive-Industrie beschränkt und haben sich bereits ein Standbein in anderen Märkten aufgebaut. Im Automotive-Bereich muss die Abhängigkeit von den deutschen Herstellern reduziert werden. Oder noch allgemeiner formuliert: die Abhängigkeit von den europäischen Fahrzeugbauern. So können regionale Down-Zyklen besser kompensiert werden. Absatzmärkte in Asien oder den USA bieten Chancen. Skaleneffekte können aufgebaut und genutzt werden.
Welche Ursachen hat die Schwäche der Automobilindustrie in Europa – macht man es sich zu einfach, wenn man den Schuldigen im „Green Deal“ der EU sucht?
Den Schuldigen im Green Deal allein zu suchen greift auf jeden Fall zu kurz und ist auch nicht angebracht. Fest steht, die Branche steht europaweit unter Druck: sinkende Nachfrage, verstärkter internationaler Wettbewerb, steigende Produktions- und Lohnkosten, hohe Energiekosten, Umweltauflagen, Aufholbedarf bei Software und Technologie – die Gründe sind vielfältig, und sie betreffen Hersteller und Zulieferer gleichermaßen.
Die EU hat nun einen „Action Plan“ für die Automobilindustrie angekündigt – sind davon wichtige Impulse zu erwarten?
Der Action Plan der EU adressiert wichtige Zukunftsfelder – wie etwa automatisiertes und autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz, Batterien und Kreislaufwirtschaft. Auch die Förderung einer Software-Plattform für Software-Defined Vehicles ist ein richtiger Impuls, der jetzt möglichst unbürokratisch umgesetzt werden sollte. Insgesamt adressiert der Action Plan aber vor allem die großen Hersteller. Hier ist es wichtig, im weiteren Verlauf die Zulieferer stärker zu berücksichtigen und miteinzubeziehen. Insbesondere mit Blick auf Österreich und die Stärkung der Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit gibt es noch Luft nach oben.
Auf welche Schritte hoffen Autozulieferer nun?
Hoffnung ist zu wenig. Vor allem Hoffnung auf verlässlichere politische Rahmenbedingungen, die eine langfristige und strategische Planung für die Unternehmen ermöglichen. Wichtig ist ein aktiver Umgang mit den Rahmenbedingungen, zum Beispiel mit Implikationen aus der veränderten Zollsituation. Hier müssen Autozulieferer sich ein Bild machen und Szenarien entwickeln.
Das Schlagwort Software-Defined Vehicle ist längst eine Realität, Tesla und zahlreiche chinesische Hersteller zeigen das auf vielfältige Weise vor. Es geht nicht mehr um traditionelle Themen wie das oft strapazierte Spaltmaß, sondern in großem Maße um das Arbeiten mit Bits und Bytes. Partnerschaften und Ecosysteme sind entscheidend, um Skalierung und Innovation zu ermöglichen. Ein Hebel für die Zulieferer sind Unternehmenstransformationen. Entweder durch Carve-outs, um sich finanziellen Spielraum zu verschaffen, oder die Nutzung des aktuellen Marktumfelds für Zukäufe. Wichtig ist nicht wie der Hase vor der Schlange zu sitzen, sondern tätig zu werden und seine Hausaufgaben zu machen. Wir haben in Österreich großartige Unternehmen und Unternehmer, die mehr als Hidden Champions sind, und es auch bleiben sollen.
Zur Person
Stefan Rathausky ist Senior Director bei Alvarez & Marsal. Er hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in börsennotierten und privaten Unternehmen und berät Unternehmen aus der Automobil- und produzierenden Industrie.